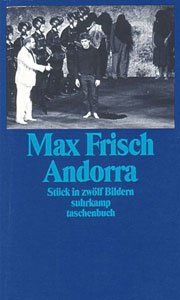
- Drama
- Nachkriegszeit
Worum es geht
Das Modell Andorra
Andorra ist bei Frisch ein fiktiver Staat, der an das ebenso fiktive Nachbarland der Schwarzen grenzt. Die Andorraner sind ein kleinbürgerliches, patriotisches, in Klischeevorstellungen verharrendes Volk, das sich vor einem möglichen Angriff der ihnen verhassten, weil überlegenen Schwarzen fürchtet. Die Schwarzen verfolgen alle Juden – und Andri wird von seinem Vater, einem Lehrer in Andorra, als ein vor den Schwarzen gerettetes Judenkind ausgegeben. Unter diesem Stigma und den Vorurteilen der Andorraner leidet Andris Selbstbewusstsein erheblich. Als seine leibliche Mutter erscheint – keine Jüdin, sondern eine Schwarze –, kann er die Wahrheit nicht anerkennen, da er sich tatsächlich schon als der Jude fühlt, als den ihn seine intoleranten Landsleute sehen. Wenig später fallen die Schwarzen in Andorra ein und die Bürger sehen während einer „Judenschau“ zu, wie der unschuldige Andri hingerichtet wird. Das 1961 uraufgeführte Bühnenstück von Max Frisch zeigt viele Parallelen zur Situation der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Auch dort war Antisemitismus weit verbreitet, und eine große Zahl aus Deutschland flüchtender Juden wurde an der Grenze abgewiesen. Frischs Andorra ist gleichwohl als Modell zu verstehen: Jedes Land kann zu einem Andorra werden. Das Stück war ein großer Erfolg und wurde auf allen wichtigen deutsprachigen Bühnen gespielt.
Zusammenfassung
Über den Autor
Max Frisch wird am 15. Mai 1911 als Sohn eines Architekten in Zürich geboren. Nach dem Gymnasium beginnt er ein Germanistikstudium, bricht es 1934 ab, arbeitet als freier Journalist, u. a. als Sportreporter in Prag, und verfasst Reiseberichte. Er ist vier Jahre mit einer jüdischen Kommilitonin liiert, die er heiraten will, um sie vor Verfolgung zu schützen, sie lehnt jedoch ab. Ab 1936 studiert er in Zürich Architektur, 1940 macht er sein Diplom. Ein Jahr später gründet er ein Architekturbüro und arbeitet gleichzeitig als Schriftsteller. Er heiratet 1942 seine ehemalige Studienkollegin Gertrud (Trudy) Constance von Meyenburg, mit der er drei Kinder hat. 1951 hält sich Frisch für ein Jahr in den USA und in Mexiko auf. 1954 erscheint sein erster Roman: Stiller. Das Buch ist so erfolgreich, dass Frisch sich nun ganz der Schriftstellerei widmen kann. 1955 löst er sein Architekturbüro auf und bereist die USA, Mexiko, Kuba und Arabien. 1958 erhält er den Georg-Büchner-Preis und den Literaturpreis der Stadt Zürich, ein Jahr später wird seine erste Ehe geschieden. 1960 zieht Frisch nach Rom, wo er fünf Jahre lang mit der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann zusammenlebt – und die 23-jährige Studentin Marianne Oellers kennen lernt. 1961 wird das Theaterstück Andorra uraufgeführt, ein Gleichnis über die fatale Wirkung von Vorurteilen. 1964 erscheint der Roman Mein Name sei Gantenbein. Im Folgejahr übersiedelt Frisch zurück ins Tessin in die Schweiz. 1966 und 1968 unternimmt er größere Reisen in die UdSSR, 1970 folgt wieder ein längerer USA-Aufenthalt. Inzwischen hat er Marianne Oellers, mit der er jahrelang zusammengelebt hat, geheiratet. 1975 veröffentlicht Frisch die autobiografisch gefärbte Erzählung Montauk. Schweizkritische Schriften wie Wilhelm Tell für die Schule (1971) führen in seiner Heimat zu Widerspruch, in Deutschland findet er mehr Anerkennung. 1976 erhält er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Max Frisch stirbt am 4. April 1991 in Zürich an Krebs.
















Kommentar abgeben oder Diskussion beginnen