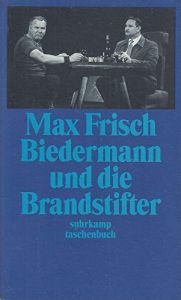
- Drama
- Nachkriegszeit
Worum es geht
Brandgefährliches Lehrstück
Was tun, wenn’s brennt? Diese Frage stellt sich auch für Herrn Biedermann, der in der Zeitung von immer neuen, immer dreisteren Brandstiftungen liest. Dass er schließlich selbst Opfer von Brandstiftern wird, will er so lange nicht wahrhaben, bis es zu spät ist. Die beiden Hausierer Schmitz und Eisenring müssen sich gar nicht besonders verstellen, denn allein ihre unverhohlen zur Schau gestellte Bedrohlichkeit, mit der sie ihr zündelndes Geschäft betreiben, verschafft ihnen bei Biedermann so viel Respekt, dass er nur eine Möglichkeit sieht: alle Warnungen in den Wind schlagen und sich „anbiedern“. Er lässt die Brandstifter in sein Haus, lädt sie zu einem üppigen Gastmahl ein und stellt sich taub und blind, wenn er mit der bevorstehenden Katastrophe konfrontiert wird. Biedermann ist Opfer und Helfershelfer zugleich, ein Opportunist bar jeder Zivilcourage, dem es nur darum geht, seine eigene Haut zu retten. Das ironische Stück wurde 1958 uraufgeführt und bedeutete für den als Romanschriftsteller bereits erfolgreichen Max Frisch den Durchbruch als Bühnenautor. Der einfache Aufbau, der bitterböse Humor, die Zeitlosigkeit des Sujets und nicht zuletzt der Titel, der zum geflügelten Wort wurde, verhalfen dem „Lehrstück ohne Lehre“ zu großer Popularität.
Zusammenfassung
Über den Autor
Max Frisch wird am 15. Mai 1911 als Sohn eines Architekten in Zürich geboren. Nach dem Gymnasium beginnt er ein Germanistikstudium, bricht es 1934 ab, arbeitet als freier Journalist, u. a. als Sportreporter in Prag, und verfasst Reiseberichte. Er ist vier Jahre mit einer jüdischen Kommilitonin liiert, die er heiraten will, um sie vor Verfolgung zu schützen, sie lehnt jedoch ab. Ab 1936 studiert er in Zürich Architektur, 1940 macht er sein Diplom. Ein Jahr später gründet er ein Architekturbüro und arbeitet gleichzeitig als Schriftsteller. Er heiratet 1942 seine ehemalige Studienkollegin Gertrud (Trudy) Constance von Meyenburg, mit der er drei Kinder hat. 1951 hält sich Frisch für ein Jahr in den USA und in Mexiko auf. 1954 erscheint sein erster Roman: Stiller. Das Buch ist so erfolgreich, dass Frisch sich nun ganz der Schriftstellerei widmen kann. 1955 löst er sein Architekturbüro auf und bereist die USA, Mexiko, Kuba und Arabien. 1958 erhält er den Georg-Büchner-Preis und den Literaturpreis der Stadt Zürich, ein Jahr später wird seine erste Ehe geschieden. 1960 zieht Frisch nach Rom, wo er fünf Jahre lang mit der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann zusammenlebt – und die 23-jährige Studentin Marianne Oellers kennen lernt. 1961 wird das Theaterstück Andorra uraufgeführt, ein Gleichnis über die fatale Wirkung von Vorurteilen. 1964 erscheint der Roman Mein Name sei Gantenbein. Im Folgejahr übersiedelt Frisch zurück ins Tessin in die Schweiz. 1966 und 1968 unternimmt er größere Reisen in die UdSSR, 1970 folgt wieder ein längerer USA-Aufenthalt. Inzwischen hat er Marianne Oellers, mit der er jahrelang zusammengelebt hat, geheiratet. 1975 veröffentlicht Frisch die autobiografisch gefärbte Erzählung Montauk. Schweizkritische Schriften wie Wilhelm Tell für die Schule (1971) führen in seiner Heimat zu Widerspruch, in Deutschland findet er mehr Anerkennung. 1976 erhält er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Max Frisch stirbt am 4. April 1991 in Zürich an Krebs.









Kommentar abgeben