- Roman
- Moderne
Worum es geht
Eine Geschichte von Herr und Knecht
Wie kommt es, dass man beim Namen Walser immer nur an Martin Walser denkt? Das Schicksal wollte es so, dass der Schweizer Robert Walser literarisch stets im Schatten seines deutschen Namensvetters stehen sollte. Bis heute ist das Werk Robert Walsers ein Geheimtipp unter Kennern. Von seinen drei Romanen ragt der mittlere besonders heraus: In Der Gehülfe verarbeitete der Autor, aus der Distanz eines längeren Aufenthaltes in Berlin, seine Vergangenheit als Angestellter bei einem Erfinder am idyllischen Zürichsee. Walsers Held Joseph Marti betritt die Erfinderwerkstatt des Herrn Tobler mit einer seltsamen Mischung aus Neugier und Angst: Fortwährend kämpft er gegen diese widerstrebenden Gefühle an. Er bemerkt wohl, dass die Erfindungen des aufbrausenden und über seine Verhältnisse lebenden Tobler längst Schnee von gestern sind. Doch er nimmt es hin, schweigt, lässt sich einlullen und muss nun zusehen, wie sein Herr und Meister in die Katastrophe schlittert. Der Roman, den Max Liebermann als „kotzlangweilig“ beschrieb, tuckert in der Tat recht beschaulich daher. Walsers Stil ist gemächlich, zart, aber auch humorvoll und bisweilen sarkastisch. Der große Erfolg blieb Walser versagt; erst in den 70er Jahren wurden seine Romane wiederentdeckt.
Zusammenfassung
Über den Autor
Robert Walser wird am 15. April 1878 in Biel im Kanton Bern geboren. Hier absolviert er nach der Schulzeit eine Banklehre. In den Jahren 1896–1905 lebt er überwiegend in Zürich, arbeitet dort als Angestellter in Banken und Versicherungen, als Buchhändler und technischer Gehilfe eines Ingenieurs, aber auch – nach einer entsprechenden Ausbildung in Berlin – in Oberschlesien als Diener. Erste Gedichte verschaffen ihm Zugang zu literarischen Kreisen. Nach Erscheinen seines Debüts, Fritz Kochers Aufsätze (1904), folgt Walser 1906 seinem Bruder Karl nach Berlin, der dort als Maler und Bühnenbildner arbeitet und ihn in die Künstlerszene einführt. Walser verfasst in rascher Folge die Romane Geschwister Tanner (1907), Der Gehülfe (1908) und Jakob von Gunten (1909). Trotz der Anerkennung durch Künstlerkollegen kehrt er Berlin wieder den Rücken. Überzeugt davon, literarisch gescheitert zu sein, reist er 1913 in seine Heimatstadt Biel zurück. Im Hotel „Blaues Kreuz“ mietet er eine Mansarde, wo er unter ärmlichsten Bedingungen lebt und schreibt. Hier entstehen eine Sammlung von Kurzprosatexten und die Erzählung Der Spaziergang (1917). Trotz der Präsenz in literarischen Zeitschriften kommt es nur noch zu einer Buchveröffentlichung: Die Rose (1925). Den so genannten Räuber-Roman von 1925 hinterlässt er nur als Entwurf, in mikroskopisch kleiner Schrift (Mikrogramm). Die Entzifferung soll mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Wegen psychischer Labilität lässt sich Walser 1929 in die psychiatrische Klinik Waldau bei Bern einweisen. Bis 1933 schreibt er weiter, danach muss er aufgeben und wird gegen seinen Willen in die Heilanstalt Herisau im Kanton Appenzell überstellt. Dort vegetiert er weitere 23 Jahre dahin, unerkannt und unbeachtet. Auf einem einsamen Spaziergang im Schnee verstirbt er am 25. Dezember 1956.


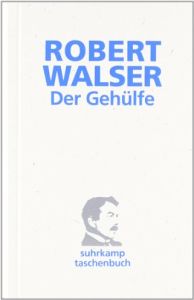







Kommentar abgeben