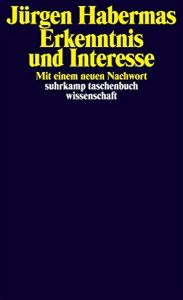
- Philosophie
- Moderne
Worum es geht
Theoretisch auf dem Weg zur Praxis
Odo Marquard bezeichnete die Geschichte der Philosophie als Geschichte eines allmählichen Kompetenzverlusts: Zuletzt sei die Philosophie nur noch kompetent für das „Eingeständnis der eigenen Inkompetenz“. Wenn dem so ist, haben wir mit Erkenntnis und Interesse gleichsam die letzte Stellung der Philosophie in einem langen Rückzugsgefecht vor uns. Habermas geht dieses Rückzugsgefecht bemerkenswert offensiv an: Die Philosophie müsse eine Sonderrolle spielen, fordert er, nämlich quasi die eines Aufsichtsrats des unaufhaltsam expandierenden Unternehmens Wissenschaft; leugnenden Stimmen zum Trotz besitze sie doch eine Spezialkompetenz: die Fähigkeit, das emanzipatorische Interesse der Menschheit an Erkenntnis zu durchschauen. Eine um diese Einsicht bereicherte kritische Philosophie gelte es zu erschaffen. Nur sie könne den Schleier herrschaftslegitimierender Illusion zerreißen, die zweckrationalistische Verarmung des modernen Erkenntnisbegriffs rückgängig machen und so der Gesellschaft wieder auf den Weg zum Erwachsenwerden zurückhelfen. Ein ehrgeiziges Programm, das mit großem Ernst verfolgt wird. Wie dieses Programm umzusetzen ist, bleibt offen: Das Werk erschöpft sich in minutiösen philosophischen Analysen seiner Notwendigkeit.
Zusammenfassung
Über den Autor
Jürgen Habermas wird am 18. Juni 1929 in Düsseldorf geboren und wächst in Gummersbach in einem konservativ-bürgerlichen Umfeld auf. Als Jugendlicher erlebt er den Zweiten Weltkrieg und das Ende des Nationalsozialismus mit. Aus dieser Erfahrung heraus entwickelt er früh ein Interesse am Marxismus, beschäftigt sich aber auch mit jüdischer und christlicher Mystik. Von 1949 bis 1954 studiert Habermas Philosophie, Geschichte, Psychologie, Literatur und Ökonomie in Göttingen, Zürich und Bonn. Nach der Promotion arbeitet er zunächst freiberuflich als Journalist und schreibt u. a. für die FAZ, ehe er 1956 an der Universität Frankfurt Assistent von Theodor W. Adorno wird. Als es jedoch mit Institutsleiter Max Horkheimer zu Differenzen kommt, habilitiert sich Habermas nicht in Frankfurt, sondern 1961 an der Universität Marburg mit der Schrift Strukturwandel der Öffentlichkeit. Zeitgleich tritt er eine Professur in Heidelberg an. Ab 1965 lehrt er in Frankfurt – als Nachfolger von Horkheimer. 1968 erscheint sein einflussreiches Werk Erkenntnis und Interesse. Die Studentenbewegung findet zunächst Habermas’ Unterstützung. Mit der Zeit jedoch wandelt sich seine Einstellung, er kritisiert die Studentenführer als zu dogmatisch und realitätsfern. 1971 verlässt Habermas Frankfurt und wird Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt in Starnberg, zusammen mit Carl Friedrich von Weizsäcker. Immer wieder meldet sich Habermas öffentlich zu Wort. So auch 1977, als die RAF Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer tötet und die Philosophie der Frankfurter Schule als geistiger Wegbereiter des Terrorismus kritisiert wird. 1981 wird Habermas’ Hauptwerk Theorie des kommunikativen Handelns veröffentlicht. 1983 kehrt er an die Universität Frankfurt zurück und lehrt dort bis zu seiner Emeritierung 1994.









Kommentar abgeben