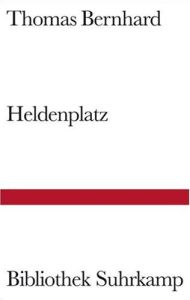
- Drama
- Gegenwartsliteratur
Worum es geht
Theatralischer Frontalangriff auf Österreich
Mit Heldenplatz unternahm Thomas Bernhard 1988, kurz vor seinem Tod, einen letzten Frontalangriff auf seine österreichischen Landsleute. Bernhard, einer der bedeutendsten deutschsprachigen Autoren der Nachkriegszeit, schrieb das Theaterstück anlässlich des 100. Geburtstags des Wiener Burgtheaters und des 50. Jahrestags von Österreichs "Anschluss" an Nazi-Deutschland. Heldenplatz spielt nach dem Selbstmord eines alten jüdischen Professors in Wien. Hausangestellte und Familie blicken auf dessen Verbitterung zurück und ereifern sich dabei in wütenden Schimpftiraden über den Judenhass der Wiener, die Stumpfsinnigkeit der Österreicher, die Verderbtheit der Politik und die Niederträchtigkeit des Menschen im Allgemeinen. Die Witwe des Verstorbenen hört im Wahn noch immer die Volksmassen schreien, die 1938 auf dem Wiener Heldenplatz Adolf Hitler begeistert willkommen hießen. Der wortmächtige Übertreibungskünstler Bernhard verzichtet auf einen klassischen Konflikt und macht den brillant aufbrausenden Text selbst zum eigentlichen dramatischen Zentrum seines Werks. Im Jahr der Premiere löste das Stück einen landesweiten Skandal aus. Die Wucht des Textes ist nach wie vor beeindruckend - heute allerdings lassen sich auch seine komischen Qualitäten genießen.
Zusammenfassung
Über den Autor
Thomas Bernhard wird am 9. Februar 1931 in den Niederlanden als unehelicher Sohn österreichischer Eltern geboren. Den Vater lernt er nie kennen. Die Mutter, eine mittellose Haushaltshilfe, gibt den Sohn zunächst in Pflege. Das Verlassensein prägt Bernhard und sein späteres Werk tief. 1932 kehrt die Mutter nach Österreich zurück, sie lebt mit dem Kind bei ihren Eltern. Bernhards Großvater Johannes Freumbichler ist ein verarmter Heimatschriftsteller, der dem Enkel bald als Vaterersatz gilt. Die Schulzeit empfindet Bernhard als Qual. 1945 misslingt ein Selbstmordversuch. Armut und schlechte Noten veranlassen ihn 1947 zur Aufgabe der Schule und zum Beginn einer Lehre. 1949 kommt er aufgrund einer Rippenfellentzündung ins Krankenhaus und entgeht nur knapp dem Tod. Dann wird Tuberkulose diagnostiziert. Bernhard verbringt knapp zwei Jahre in Krankenhäusern und Sanatorien; dort beginnt er zu schreiben und lernt auch seinen "Lebensmenschen", die 35 Jahre ältere Hedwig Stavianicek kennen. Im Anschluss arbeitet er als Journalist, später studiert er Schauspiel. 1957 veröffentlicht er seinen ersten Gedichtband Auf der Erde und in der Hölle. Doch erst der Roman Frost (1963) bringt den Durchbruch. Bernhard gilt bald als einer der wichtigsten Autoren deutscher Sprache. Auch sein zweiter Roman Verstörung (1967) wird gefeiert. 1970 inszeniert Claus Peymann Bernhards erstes langes Theaterstück Ein Fest für Boris. Damit beginnt eine fruchtbare Zusammenarbeit, denn Peymann wird etliche von Bernhards abendfüllenden Stücken auf die Bühne bringen. Bernhard setzt sich unter Schreibdruck, sei es wegen seiner Immobilienkäufe oder seiner sich verschlechternden Gesundheit. Er veröffentlicht oft mehrere Werke pro Jahr, bis ihn Mitte der 80er Jahre Atemnot und Herzschwäche langsam in die Knie zwingen. 1984 rüttelt der Roman Holzfällen die Wiener Künstlerszene auf, 1986 erscheint sein Prosa-Meisterwerk Auslöschung, und Ende 1988 erlebt Bernhard mit Heldenplatz eine letzte Skandalpremiere. Am 12. Februar 1989 stirbt Thomas Bernhard in Gmunden an Herzversagen.









Kommentar abgeben