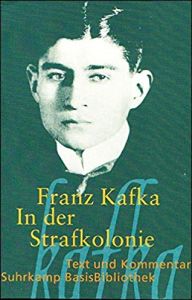
- Erzählung
- Moderne
Worum es geht
Ein kafkaesker Albtraum
Ein Forschungsreisender wird eingeladen, die in einer Strafkolonie übliche Exekutionsart kennenzulernen: Dem Verurteilten wird das Urteil mit einem nadelbesetzten Apparat in den Körper geschrieben; die Tortur dauert bis zu zwölf Stunden. Der entsetzte Reisende gerät unvermittelt in einen politischen Machtkampf, wird vom Beobachter zum Richter über den Erhalt oder die Abschaffung dieser Form der Hinrichtung. Er spricht sich gegen die unmenschliche Prozedur aus – und bewirkt damit, dass ihr Hauptverfechter selbst durch diesen Apparat getötet wird. Dies ist nur eine der vielen paradoxen Wendungen der kurzen Erzählung In der Strafkolonie, einem Paradebeispiel des einzigartigen Stils, durch den Kafka zum Klassiker der modernen Literatur wurde. Mit knapper Sprache gibt er eine mysteriöse und abgründige Geschichte völlig unbeteiligt wieder, wie einen beunruhigenden Traum. Ebenso „kafkaesk“ ist der Inhalt: ein vielschichtiges Bedeutungsgewirr, das Autobiografisches mit Zeitgeschichtlichem, Abhandlungen über Sprache mit Reflexionen über Gesetz und Recht mischt und durch keine der zahlreichen Deutungen restlos aufgeklärt wird. Ein beunruhigendes und noch heute rätselhaftes Werk.
Zusammenfassung
Über den Autor
Franz Kafka wird am 3. Juli 1883 in Prag geboren. Als deutschsprachiger Jude gehört er gleich in doppelter Hinsicht einer Minderheit an. Der Vater Hermann Kafka ist Kaufmann, die Mutter Julie im Geschäft des Vaters tätig; so wächst das Kind in der Obhut verschiedener Dienstboten auf. Der lebenstüchtige Vater bringt für seinen kränklichen, künstlerisch begabten Sohn kein Verständnis auf − ein Konflikt, der das gesamte Werk Kafkas prägen wird. Nach dem Abitur möchte Kafka eigentlich Philosophie studieren, entscheidet sich aber nach dem Willen des Vaters für Jura und promoviert 1906. Danach arbeitet er bei einer Unfallversicherung. Sein Beruf ist ihm eine Last, weil ihm zu wenig Zeit zum Schreiben bleibt; er erledigt die Arbeit aber gewissenhaft. Auf Schaffensphasen, in denen er Nächte durchschreibt, folgen längere unproduktive Abschnitte. 1902 lernt er Max Brod kennen, eine lebenslange Künstlerfreundschaft beginnt. Ab 1908 veröffentlicht er kurze und längere Erzählungen in Zeitschriften und als Buchpublikationen, darunter Die Verwandlung (1915) und Das Urteil (1916). Er beginnt drei Romane, Der Verschollene (später veröffentlicht unter dem Titel Amerika), Der Prozess und Das Schloss, stellt aber keinen fertig – für ihn ein fundamentales Scheitern. Kafkas Beziehungen zu Frauen sind problematisch. 1912 lernt er bei Max Brod die Berlinerin Felice Bauer kennen, mit der er sich zweimal verlobt und wieder entlobt. Auch die weiteren Beziehungen sind nicht von Dauer. 1917 erkrankt er an Tuberkulose. Immer wieder muss er seine berufliche Arbeit unterbrechen, um sich an Ferienorten, in Sanatorien oder bei seiner Schwester Ottla zu erholen. Die gewonnene Zeit kann er aber nicht in gewünschter Weise in Literatur umsetzen. Als er am 3. Juni 1924 stirbt, hat er Max Brod testamentarisch angewiesen, seine unveröffentlichten Manuskripte zu vernichten. Der Freund hält sich nicht daran und ermöglicht so den Weltruhm Franz Kafkas.









Kommentar abgeben