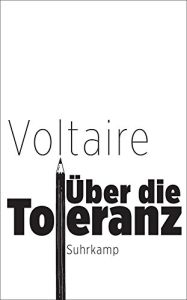
- Philosophie
- Aufklärung
Worum es geht
Streitschrift für ein tolerantes Christentum
Voltaires Traktat Über die Toleranz ist ein zeitloses Dokument, das die Notwendigkeit der religiösen Mäßigung eindringlich darlegt. Es ist ein Plädoyer für die Einsicht, dass der Mensch zu klein und zu unbedeutend ist, um die unendliche Größe Gottes zu verstehen, und setzt Demut gegen Größenwahn, Menschlichkeit gegen Dogmatismus. Wo immer religiöser Fanatismus entsteht, entgegnet Voltaires Abhandlung klar und deutlich: „Mensch, du erhebst dich über Gott, wo du andere Menschen aufgrund ihres Glaubens richtest.“ Den säkularen Fanatismus – der sich nicht auf die Zugehörigkeit zu einer Religion, sondern auf die Zugehörigkeit zu einem Stand, einer Rasse oder einer Nation stützt –, spart Voltaire aus. Aus heutiger Sicht greift er damit thematisch zu kurz, denn die Gräuel der Französischen Revolution, des Nationalismus und des Rassismus werden mit Voltaires Ansatz nur bedingt erfasst. In Zeiten der Verfolgung und Ermordung Andersgläubiger durch fanatische Islamisten ist Voltaires Text dennoch überaus aktuell.
Take-aways
Über den Autor
Voltaire ist zeit seines Lebens ein Freigeist, der sich über Konventionen hinwegsetzt, jede Form von Dogmatismus hasst, sich gegen die Kirche wendet und für die Aufklärung einsteht, die absolutistische Monarchie verflucht und dafür mehrere Male in den Kerker geworfen wird. Er hat einen großen Gerechtigkeitssinn, ist aber auch reizbar, gewinnsüchtig und ehrgeizig. Voltaire kommt unter dem bürgerlichen Namen François-Marie Arouet am 21. November 1694 als Sohn eines Notars in Paris zur Welt. Seine Mutter stirbt früh, und auf Anraten eines Freundes wird er als Zehnjähriger in ein Jesuitenkolleg geschickt. Hier trifft er auf adlige Kinder aus den besten Familien und lernt „Latein und dummes Zeug“, wie er später einmal bemerkt. Sein Pate führt ihn in die höfische Gesellschaft ein. Das Leben im Luxus gefällt dem jungen Mann: In der Gesellschaft liebt man ihn für seinen intelligenten Witz, seinen bösartigen Humor und seine Frechheit, mit der er auch höhergestellten Personen begegnet. Das wird ihm schließlich aber zum Verhängnis: Mehrere Male wird er aus der Gesellschaft verbannt. 1718 erscheint seine überaus erfolgreiche Tragödie Oedipus (Oedipe). In die Pariser Gesellschaft zurückgekehrt, wird er 1726 in die Bastille gesperrt. Der Grund ist eine Auseinandersetzung mit dem Feldmarschall Chevalier de Rohan. Den Aufenthalt in der Bastille kann Voltaire abkürzen, indem er sich zum Exil in England bereit erklärt. In den Philosophischen Briefen (Lettres philosophiques, 1734) richtet er sich polemisch gegen französische Rückständigkeit, Dogmatismus, Willkürherrschaft und religiöse Herrschaftsansprüche. Natürlich zieht das einen erneuten Konflikt nach sich. Voltaire flieht ins Château de Cirey im Herzogtum Lothringen. Auf Vermittlung der Marquise de Pompadour steigt Voltaire 1746 zum Kammerherrn Ludwigs XV. auf, nimmt 1749 aber eine Einladung Friedrichs II. von Preußen an. Doch auch hier kommt es zum Zerwürfnis. 1758 kauft sich Voltaire das Gut Ferney in der Nähe von Genf, wo er 20 Jahre lang lebt und schreibt. 1778 reist er zur Uraufführung einer seiner Tragödien nach Paris, wo er am 30. Mai 1778 stirbt. Auf Volksbeschluss wird sein Leichnam 1791 ins Panthéon in Paris verlegt.












Kommentar abgeben oder Diskussion beginnen