Melden Sie sich bei getAbstract an, um die Zusammenfassung zu erhalten.
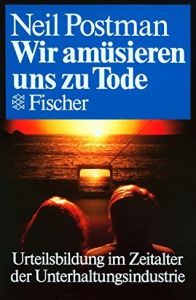
Melden Sie sich bei getAbstract an, um die Zusammenfassung zu erhalten.
Neil Postman
Wir amüsieren uns zu Tode
Urteilsbildung im Zeitalter der Unterhaltungsindustrie
Fischer Tb, 2006
Was ist drin?
Die schöne neue Welt des Fernsehens – technologischer Fortschritt oder intellektuelle Katastrophe?
- Sprache & Kommunikation
- Moderne
Worum es geht
Der Kreuzzug der Unterhaltung gegen die Rationalität
Als Neil Postman in den frühen 1980er Jahren Wir amüsieren uns zu Tode verfasste, war das Fernsehen in Amerika auf dem Höhepunkt seiner Wirkungskraft. Der Medienwissenschaftler untersuchte die tief greifenden Veränderungen, die das TV auf unser Verständnis der Welt und auf unsere Kommunikation hat. Er stellte dabei besonders die Gegensätze zwischen einer vom Buchdruck und einer vom Fernsehen geprägten Gesellschaft heraus. Sein Fazit lautet grob gesagt: Das Fernsehen macht aus uns ungebildete, schlecht informierte Konsumenten, die zu keinem ernsthaften öffentlichen Diskurs mehr fähig sind. Während Postman das Buch verfasste, waren schon die ersten Anzeichen des kommenden Computerzeitalters spürbar, das unsere Kommunikationswelt wohl noch tief greifender als das Fernsehen verändert hat und manche Erkenntnisse Postmans überholt erscheinen lässt. Dennoch ist Wir amüsieren uns zu Tode auch heute noch lesenswert. Denn es macht kompromisslos klar, dass jeder technologische Fortschritt, jedes neue Medium kritisch hinterfragt werden muss, dass die schnellere Information nicht unbedingt auch die bessere ist und dass unsere Bildung Priorität vor der Unterhaltung haben muss.
Take-aways
- Wir amüsieren uns zu Tode ist eine der bekanntesten medienkritischen Schriften des späten 20. Jahrhunderts.
- Neil Postman diagnostiziert darin den Verfall menschlicher Werte durch die vollkommene Vergnügungssucht.
- Besonders das Medium Fernsehen wird von Postman scharf kritisiert.
- Jedes neue Medium verändert unsere Wahrnehmung der Welt, wirkt sich auf unsere Kommunikation aus und beeinflusst unsere Vorstellung von Wahrheit und Wissen.
- Bücher zeichnen sich dadurch aus, dass sie Informationen sinnvoll zusammengefasst, kohärent und rational vermitteln.
- Als das Buch noch das vorherrschende Medium war, waren die öffentlichen Diskurse geprägt von Rationalität und Ernsthaftigkeit.
- Die Diskurse des Fernsehzeitalters sind gekennzeichnet durch Zusammenhangslosigkeit, Geschichtslosigkeit und fehlende Komplexität.
- Im (amerikanischen) Fernsehen wird jedes Thema, sei es Religion, Bildung oder Politik, zum Entertainment.
- Mit der Entwicklung vom Buchdruck- zum Fernsehzeitalter geht ein Rückschritt der intellektuellen Ausdrucksformen einher.
- Die einzige Möglichkeit, die negativen Auswirkungen dieses Wandels abzuschwächen, ist die Entwicklung eines kritischen Medienbewusstseins.
- Postmans einseitige Bevorzugung der Schrift- vor der Bildkultur wurde heftig kritisiert.
- Bis zu seinem Tod 2003 blieb Postman ein überzeugter Gegner nicht nur des Fernsehens, sondern der modernen Kommunikationstechnologien allgemein.
Zusammenfassung
Medien im Wandel
Zwar hat sich George Orwells Zukunftsvision aus 1984 nicht bewahrheitet, dafür aber die von Aldous Huxley in Schöne neue Welt. Entgegen landläufiger Meinung haben die beiden Autoren nicht dasselbe geweissagt: Während der von Orwell prophezeite Zusammenbruch der Demokratie nicht eingetroffen ist, manifestiert sich Huxleys Tyrannei des Vergnügens in der Allgegenwärtigkeit des Fernsehens.
„Wie die Sprache selbst, so begründet auch jedes neue Medium einen bestimmten, unverwechselbaren Diskurs, indem es dem Denken, dem individuellen Ausdruck, dem Empfindungsvermögen eine neue Form zur Verfügung stellt.“ (S. 19)
Schon Platon bemerkte, dass die Form des Gesprächs, des kommunikativen Austauschs, einen großen Einfluss auf den Inhalt desselben hat. Auf die heutige Zeit angewandt kann man also fragen, inwieweit die Form des Mediums, mit dem Informationen vermittelt werden, das beeinflusst, was mit ihm vermittelt wird. Das Fernsehen setzt dabei, entgegen den älteren Medien, auf einen Austausch in Bildern. Dieser Wandel vom Buchdruckzeitalter zum Fernsehzeitalter ist nur vergleichbar mit dem Wandel von der Sprache zum geschriebenen Wort. Jedes neue Medium gibt dem, was wir erfahren und worüber wir reden, eine neue Form und führt uns so zu einer neuen Weltanschauung. Medien können also insofern als Metaphern verstanden werden, als sie uns die Welt nur durch ihre jeweilige Form gefiltert wahrnehmen lassen. So wie erst durch die Uhr die Zeit als unabhängige, präzise Abfolge von Zeiteinheiten wahrgenommen wurde, prägen unsere Sprachen, unsere Medien, die Wahrnehmung der Welt.
Medien, Wissen und Wahrheit
Die Epistemologie ist die Wissenschaft davon, wie wir zu Wissen und Erkenntnis gelangen und wie wir Wahrheit definieren. Sie beschäftigt sich u. a. damit, wie sich die Vorherrschaft eines bestimmten Mediums in einer Gesellschaft auf unseren Wahrheitsbegriff auswirkt. Der Begriff der Resonanz beschreibt hierbei die Auswirkungen eines Mediums über seinen eigentlichen Wirkungsbereich hinaus auf eine gesamte Kultur. So hat etwa die Mündlichkeit mit der Verbreitung des Buchdrucks zwar an Resonanz verloren, in machen Teilen unserer Kultur, etwa im Fall von Zeugenaussagen, ist sie aber noch immer sehr stark. Die Resonanz eines Mediums besteht also auch aus dem, was wir aufgrund dieses Mediums für wahr halten. In jeder Epoche und in jeder Kultur gibt es somit bestimmte Kommunikationsformen, die "Wahrheit" fördern, weil sie Aussagen glaubwürdiger machen. Mit der Veränderung des jeweiligen Diskurses und dem Wandel dessen, was glaubwürdig ist, verändern sich auch unsere Vorstellungen von Intelligenz. Das Fernsehen stellt an unseren Intellekt ganz andere Anforderungen als gesprochene oder geschriebene Sprache. Es verdrängt zusehends die Definitionen von Wahrheit und Wissen, wie sie durch Bücher gefördert wurden.
Diskurse im Zeitalter des Buchdrucks
Am Beispiel Amerikas im 18. und 19. Jahrhundert lässt sich gut illustrieren, wie sich das vorherrschende Medium in einer Gesellschaft auf deren Diskurse auswirken kann. In dieser Zeit konnten etwa 90 % der männlichen und 60 % der weiblichen Bevölkerung Amerikas lesen und schreiben. In Ermangelung einer anderen Alternative als der mündlichen Überlieferung fand der gesamte Austausch, ob zu religiösen, politischen oder sozialen Themen, in schriftlicher Form statt. Durch die Bevorzugung des "Selbst-Lesens" in der puritanischen und calvinistischen Tradition, die frühe Einrichtung von Schulen und die literarische Tradition Englands, die auf den neuen Kontinent überführt wurde, war Amerika in den frühen Jahren in allen Schichten ein Volk von Lesern. Unter Intelligenz wurde in dieser Zeit verstanden, den Verstand rational und objektiv zu nutzen, was u. a. an der Fähigkeit abzulesen war, sich in einer bestimmten, am Geschriebenen orientierten Form zu seinen Ansichten äußern zu können. Deshalb kann man dieses Zeitalter auch als Zeitalter der Erörterung bezeichnen, da die rational-analytische und in sich schlüssige Form der Erörterung die Grundlage jeglichen Diskurses bildete.
Voraussetzungen des Fernsehzeitalters
Vor allem zwei Erfindungen sind die Ursachen für die Vorherrschaft des Mediums Fernsehen in der amerikanischen Gesellschaft: Telegrafie und Fotografie. Durch den Telegrafen wurde aus dem öffentlichen Diskurs, der bisher auf kleinere Regionen beschränkt war, ein nationaler, der sich vor allem dadurch auszeichnete, dass (für den Einzelnen) belanglose Nachrichten ohne sichtbaren Zusammenhang im ganzen Land verbreitet werden konnten. Dies veränderte grundlegend den Begriff der Information: Bislang wurde sie als wertvoll angesehen, wenn sie Auswirkungen auf die Handlungen der einzelnen Empfänger hatte; nun aber wurde der Wert einer Information allein daran gemessen, wie neu und wie interessant sie war. Im Gegensatz zum Buch, das darauf ausgelegt ist, Informationen zu sammeln, zu erörtern und zu analysieren, kann der Telegraf nur übermitteln, ohne die Informationen in einen sinnvollen Zusammenhang zu stellen. So wurde die Sprache des neuen Diskurses eine Sprache der Schlagzeilen.
„Wir sehen die Natur, die Intelligenz, die menschliche Motivation oder die Ideologie nicht so, wie sie sind, sondern so, wie unsere Sprachen sie uns sehen lassen. Unsere Sprachen sind unsere Medien. Unsere Medien sind unsere Metaphern. Unsere Metaphern schaffen den Inhalt unserer Kultur.“ (S. 25)
Die zweite wichtige Voraussetzung für das heutige Fernsehzeitalter liegt im Streben des Menschen nach Abbildung der Natur, das in der Erfindung der Fotografie seinen Höhepunkt fand. Mit der Möglichkeit der unbegrenzten Vervielfältigung hielt das Bild Einzug in die amerikanische Kultur und wirkte sich mit seinen besonderen Eigenschaften auf die Vorstellung von Nachrichten und Informationen aus: Fotos können nicht wahr oder falsch sein, sie sind unwiderlegbar, sie haben keinen Kontext, sondern stehen immer für sich selbst. Letztendlich kann gesagt werden, dass mit der beginnenden Verbreitung der Fotografie eine optische Revolution einsetzte - ein Angriff des Bildes auf die Sprache.
„‚Wahrheit' ist so etwas wie ein kulturelles Vorurteil. Jede Kultur beruht auf dem Grundsatz, dass sich die Wahrheit in bestimmten symbolischen Formen besonders glaubwürdig ausdrücken lässt, in Formen, die einer anderen Kultur möglicherweise trivial oder belanglos erscheinen.“ (S. 34)
Aus diesen beiden Entwicklungen gingen also in Amerika Kommunikationsformen hervor, die auf Bildern und auf Augenblicklichkeit beruhten. Es entstand eine "Guckguck-Welt", in der Informationen nur für einen kurzen Augenblick Aufmerksamkeit verlangen, um kurz darauf wieder vergessen zu werden. Doch erst das Fernsehen verband beide Strömungen perfekt und organisierte unsere gesamte Kommunikationsumwelt nach den Prinzipien des Bildes und der Augenblicklichkeit.
Aufgaben und Auswirkungen des Fernsehens
Es ist vollkommen falsch, zu denken, das Fernsehen sei in irgendeiner Form eine Erweiterung der Schriftkultur. Beide stehen vielmehr in einem strengen Gegensatz zueinander. Um das zu sehen, muss das Fernsehen jedoch als Medium, nicht als Technik verstanden werden. Die bloße Technik ist in allen Ländern der Welt dieselbe; Fernsehen mit dem unangefochtenen Status des Mediums findet man wohl einzig in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort hat das Fernsehen als Medium nur eine einzige Aufgabe: die Unterhaltung. Jedes Thema, jedes Sendeformat muss sich diesem Hauptziel unterordnen. Dabei steht die Wirkung der gezeigten Bilder im Vordergrund; die Kriterien für eine gelungene sprachliche Kommunikation, wie wir sie etwa bei Büchern anwenden, hat keinerlei Bedeutung.
„Im 18. und 19. Jahrhundert brachte der Buchdruck eine Definition von Intelligenz hervor, die dem objektiven, rationalen Gebrauch des Verstandes Vorrang gab und gleichzeitig Formen eines öffentlichen Diskurses mit ernsthaftem, logisch geordnetem Inhalt förderte.“ (S. 69)
Die Auswirkungen des Fernsehdiskurses auf die gesamte gesellschaftliche Kommunikation sind mindestens ebenso stark wie die des Buchdrucks. Die Unterhaltung wird zur Metapher für alle Diskurse, ob im Klassenzimmer, im Gerichtssaal oder in der Kirche.
Nachrichtensendungen und Fernsehprediger
Die Fernsehnachrichten präsentieren Informationen, indem sie sie vollkommen aus ihrem Zusammenhang lösen und durch ein "Und jetzt ..." voneinander trennen. So wird klargestellt, dass die einzelnen Nachrichten weder füreinander noch für den Zuschauer irgendeine Relevanz haben. Die Wahrheit der Informationen wird in den Fernsehnachrichten weitgehend abgelöst durch die Glaubwürdigkeit des Nachrichtensprechers. Diese Glaubwürdigkeit misst sich nicht an der Wahrscheinlichkeit, dass das Gesagte wahr ist, sondern an der Attraktivität oder an dem Eindruck von Aufrichtigkeit, den der Sprecher vermittelt. Dass der Zuschauer keine ernsthafte, informative Sendung verfolgt, wird zusätzlich durch die musikalische Untermalung, die Werbepausen, die amüsanten oder interessanten Bilder und den unbeteiligten Gesichtsausdruck der Sprecher verdeutlicht. Die Information wird so zur Desinformation, die sich bloß als Information darstellt, jedoch nichts mit wirklichem Wissen gemein hat. So sind die westlichen Demokratien mehr und mehr von der von Huxley prophezeiten freiwilligen Gedankenlosigkeit geprägt. Der Austausch von Informationen wird zum "trivial pursuit", zum trivialen Zeitvertreib.
„Die Technik verhält sich zum Medium wie das Gehirn zum Verstand oder zum Denken. So wie das Gehirn ist die Technik ein gegenständlicher Apparat. So wie der Verstand ist das Medium die Art und Weise, in der man einen solchen materiellen Apparat gebraucht.“ (S. 106)
Verschiedene amerikanische Prediger bedienen sich sehr erfolgreich des Mediums Fernsehen, ohne dabei zu beachten, welchen Einfluss dies sowohl auf die Wirkung als auch auf die Inhalte ihrer Predigten hat. Die Religion wird, wie jedes andere Thema auch, im Fernsehen zur Unterhaltung. Alles Spirituelle muss sich dem Ziel des Entertainments unterordnen. Daher steht auch der Prediger, und nicht etwa Gott, im Mittelpunkt dieser Sendungen. Er wird aufgrund der spezifischen Eigenschaften des Fernsehbildes zum Götzen, der an Gottes Stelle angebetet wird. Das Ritual, das viele Religionen so anziehend macht, die sinnliche Wahrnehmung des Heiligen und die Verzauberung, geht im Fernsehen vollständig verloren. Aus dieser Entwicklung wird letztendlich die Zerstörung der Religion als authentisches Kulturobjekt und der Verlust traditioneller religiöser Vorstellungen resultieren.
Politik und Werbung
Der Kapitalismus beruht auf der Annahme, dass der potenzielle Käufer informiert, objektiv und rational Kaufentscheidungen trifft. Im Ergebnis setzt sich das jeweils beste Produkt am Markt durch. Diese Basis wird durch die Fernsehwerbung zerstört, indem sie keine rational überprüfbaren Aussagen, sondern emotional geprägte Lebensentwürfe zu ihrem Inhalt macht. Die wohl erschreckendsten Auswirkungen hat diese Entwicklung auf den politischen Diskurs. Mit der Einführung des Wahlwerbespots ist nicht länger wichtig, welcher Kandidat unsere Interessen besser vertritt oder welches Programm wir eher unterstützen können, sondern nur noch, welcher Kandidat besser wirkt und welcher Spot uns emotional eher anspricht. Das hat verheerende Folgen für die politische Meinungsbildung: Eine durch Fernsehwerbung geprägte Gesellschaft glaubt, dass die spontane und emotionale Entscheidungsgrundlage die bessere ist, dass einfache Botschaften komplexen vorzuziehen sind und dass alle Probleme schnell gelöst werden können. So verliert der politische Diskurs durch die Fernsehwerbung seinen ideologischen, gedanklichen und historischen Inhalt. Politiker werden zu Prominenten und Politik wird zur Unterhaltung.
Bildung durch Fernsehen?
Sesamstraße, die Fernseh-Kindersendung par excellence, ist gleichzeitig die erste, die sich selbst als unterrichtsbegleitende Bildungsshow versteht. Sie soll den Kindern Lust auf Schule machen, erreicht aber letztendlich nur, dass die Schule sich der Sesamstraße anpassen muss, wenn sie weiterhin interessant bleiben will. Indem er eine neue Einstellung zum Lernen fördert, untergräbt der Stil, in dem die Inhalte präsentiert werden, die klassische Büchergelehrsamkeit. Man kann in diesem Zusammenhang von einer neuen, durch das Fernsehen geprägten Bildungstheorie sprechen, die Unterricht und Unterhaltung als Einheit versteht. Dabei gelten die Gebote, die auch für alle anderen Fernsehsendungen Gültigkeit haben, ganz besonders im Rahmen des so genannten Bildungsfernsehens: Jede Sendung muss in sich geschlossen sein und darf weder etwas voraussetzen noch den Eindruck erwecken, das Gezeigte werde zu irgendeinem späteren Zeitpunkt für eine andere Sendung wichtig. Deshalb dürfen die Sendungen keinesfalls irritierende Inhalte haben, die man sich womöglich noch einprägen muss. Jegliche Form der Erörterung muss vermieden und stattdessen eine Geschichte erzählt werden.
„Problematisch am Fernsehen ist nicht, dass es uns unterhaltsame Themen präsentiert, problematisch ist, dass es jedes Thema als Unterhaltung präsentiert.“ (S. 110)
Fazit Während bei Orwell die Kultur zum Gefängnis wird, verliert sie sich bei Huxley in Trivialitäten. Wir waren immer und sind auch heute bereit, einer offen geäußerten Ideologie, die uns versklaven will, entgegenzutreten und sie zu bekämpfen. Die schleichende feindliche Übernahme durch die Fernsehideologie konnten wir aber nicht verhindern, da technische Veränderungen zwangsläufig auch Veränderungen unserer Lebenswelt nach sich ziehen. Reaktionen wie die, das Fernsehen wieder abschaffen zu wollen, oder die Menschen dazu zu bringen, einen Monat nicht fernzusehen, sind also im besten Fall als weltfremd zu bezeichnen. Stattdessen muss das Bewusstsein für die Auswirkungen des Fernsehens auf unser ganzes Leben, unsere Kommunikation geschärft werden. An den aktuellen Debatten zur Computertechnologie zeigt sich bereits, dass die Bildungsinstitutionen durchaus in der Lage sind, ein solches kritisches Medienbewusstsein zu etablieren, das vor allem im Hinblick auf das Fernsehen dringend nötig ist.
Zum Text
Aufbau und Stil
Wir amüsieren uns zu Tode ist in zwei etwa gleich lange Teile mit fünf bzw. sechs Kapiteln gegliedert. Der erste Teil beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen von Postmans Medientheorie, mit den Kennzeichen der vom Buchdruck geprägten amerikanischen Gesellschaft im 18. und 19. Jahrhundert und mit den technischen und medialen Voraussetzungen des Fernsehzeitalters. Im zweiten Teil erläutert Postman im Allgemeinen und an konkreten Beispielen (Fernsehnachrichten, Fernsehpredigten, Werbespots usw.) die Auswirkungen des Fernsehens auf die öffentlichen Diskurse. Dabei sind die einzelnen Kapitel kaum voneinander abhängig, jedes kann für sich stehen und setzt so gut wie keine Kenntnisse der vorangegangenen voraus. Postmans Sprache ist besonders in den ersten beiden Kapiteln mitunter schwer verständlich und verlangt einiges an Grundkenntnissen der Medientheorie. Von diesem behäbigen Einstieg sollte man sich jedoch nicht abschrecken lassen, da die Ausführungen zum Buchdruckzeitalter und der eigentliche Hauptteil, in dem die Kritik am Fernsehen und seinen Auswirkungen entwickelt wird, weit besser nachvollziehbar sind. Es dient sicher der Anschaulichkeit, dass Postman seinen Standpunkt immer ausführlich an konkreten Beispielen belegt, die z. T. in so drastischer Form nur in den USA, erschreckend oft jedoch auch in europäischen Gesellschaften zum Alltag gehören. So manche Analyse bleibt allerdings sehr oberflächlich und oft sind die ausgewählten Beispiele und die untersuchten Details nur auf Postmans Argumentationsziel ausgerichtet. Postmans Stil schwankt ständig zwischen Polemik und Wissenschaftlichkeit. Er ist flüssig und über weite Strecken (auch wenn der Autor das vielleicht geleugnet hätte) sehr unterhaltsam zu lesen.
Interpretationsansätze
- Postmans Abhandlung ist in erster Linie Medienkritik: Seine Untersuchung des Wandels von der Buchdruck- zur Fernsehkultur soll zeigen, dass wichtige Errungenschaften in der gesellschaftlichen, politischen und pädagogischen Sphäre durch den Einfluss des Fernsehens zerstört werden.
- Zugleich präsentiert Postman seine eigene Medientheorie. Die Ausführungen zu diesem Thema sind allerdings wesentlich kürzer als der kritische Teil. In Anlehnung an Marshall McLuhan, bekannt vor allem durch sein Hauptwerk Die Gutenberg-Galaxis, worin er die Auswirkungen verschiedener Medien auf die Menschen untersucht, entwirft Postman eine Theorie vom Medium als Metapher, das uns die Welt auf eine bestimmte Weise wahrnehmen lässt.
- Wir amüsieren uns zu Tode soll aufzeigen, wie sich im Lauf der Menschheitsgeschichte Medien auf die Gesellschaft und die Kultur ausgewirkt haben. Insofern ist das Werk auch eine Studie zur Mediengeschichte, die der Frage nachgeht, durch welche Entwicklungen ein Medium sich gegen ein anderes durchsetzt und welche Auswirkungen eine solche Vorherrschaft hat.
- Postman hat das Anliegen, die Welt über die negativen Folgen des Fernsehens aufzuklären und das Medienbewusstsein zu schärfen, indem die Medien zum Thema in der Bildung, vor allem in den Schulen, gemacht werden. Daneben kritisiert er scharf, dass vom Fernsehen geprägte Kommunikations- und Lehrformen auch auf die Schulen übergreifen.
Historischer Hintergrund
Hollywood im Weißen Haus
Nach der Watergate-Affäre und dem Rücktritt von Präsident Richard Nixon im Jahr 1974, dem Desaster in Vietnam und der Wirtschaftskrise unter Präsident Jimmy Carter war das amerikanische Selbstbewusstsein Anfang der 80er Jahre schwer erschüttert. Der neue Präsident Ronald Reagan versprach bei seiner Antrittsrede, dass sich dies unter seiner Führung ändern werde: "Wir sind eine zu große Nation, um uns auf kleine Träume zu beschränken. Die Ära der Selbstzweifel ist vorüber." Er erhöhte den Etat für das Militär drastisch und führte den Rüstungswettlauf mit der Sowjetunion zu einem neuen Höhepunkt, senkte gleichzeitig die Steuern und baute den bürokratischen Apparat ab. Durch die so etablierte militärische Vormachtstellung der USA und den wirtschaftlichen Aufschwung gab er dem amerikanischen Volk sein Selbstbewusstsein zurück.
Wie bei keinem Präsidenten zuvor beruhte Ronald Reagans Ansehen und sein Erfolg auf seiner medialen Präsenz: Als ehemaliger Schauspieler wusste er nur zu gut, wie das Fernsehen dazu genutzt werden kann, möglichst viele Menschen von sich zu überzeugen. An seinen politischen Zielen geäußerte Kritik verpuffte weitgehend, da Reagans Charme auf dem Bildschirm anscheinend größere Wirkung erzielte als die Argumente seiner Gegner. Die von seiner Politik Benachteiligten reagierten mit Desinteresse: Als Reagan 1984 zur Wiederwahl antrat, sank die Wahlbeteiligung auf unter 50 %. Nicht zuletzt aufgrund seiner ungeheuren Wirkung auf die Unentschlossenen wurde Reagan erneut zum Präsidenten gewählt.
Entstehung
Unermüdlich warnte der Medienwissenschaftler Neil Postman vor der "Trivialisierung", "Boulevardisierung" und "Infantilisierung" der Gesellschaft durch die modernen Medien. Wir amüsieren uns zu Tode sollte zugleich Analyse des Problems und Warnung für die Zukunft sein: "Ich untersuche und ich beklage in diesem Buch die einschneidendste Veränderung, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts innerhalb der amerikanischen Kultur vollzogen hat: den Niedergang des Buchdruckzeitalters und den Anbruch des Fernsehzeitalters." Als Anstoß für das Verfassen dieses Werks gilt zum einen das Verstreichen des Stichjahres 1984, für das George Orwell in seinem Buch 1984 Düsteres prophezeit hatte; neben Postman sahen sich auch verschiedene andere Denker veranlasst, die nun Realität gewordene "Zukunft" von 1984 näher zu untersuchen. Zum anderen war die Wahl Ronald Reagans zum Präsidenten der USA ein Ereignis, das für Postman zutiefst symptomatisch für das neue Zeitalter des Entertainments war: "Während ich dies schreibe, werden die Vereinigten Staaten von einem ehemaligen Hollywood-Schauspieler regiert."
Neil Postman bediente sich beim Verfassen des Buchs diverser Abhandlungen früherer Denker und wies auch des Öfteren auf deren direkten Einfluss auf sein Werk hin. Im Besonderen ist hier Marshall McLuhans Understanding Media (Die magischen Kanäle, 1964) zu nennen. Aus McLuhans Aphorismus "Das Medium ist die Botschaft" wurde Postmans "Das Medium ist die Metapher". Einigen Gemeinsamkeiten zum Trotz lehnte Postman McLuhans Ansatz entschieden ab, dass Bild- und Schriftmedien gleichermaßen sinnvoll seien und dass sie nur unterschiedlich wirken würden. Daneben griff Postman Ansätze von Theodor W. Adorno, Siegfried Kracauer und Max Horkheimer auf und verarbeitete sie, teilweise methodisch ungenau, zu einer populärwissenschaftlichen Medientheorie.
Wirkungsgeschichte
Neil Postmans Abhandlung erregte in den 80er Jahren enormes Aufsehen und gilt bis heute als Standardwerk der Medienkritik. Es gibt kaum einen Buchtitel neuerer Zeit, der so schnell zum geflügelten Wort wurde. In die Kritik geriet Wir amüsieren uns zu Tode vor allem aufgrund der übersteigerten Bevorzugung der Schrift vor dem Bild, die vielfach als zu drastisch, als unreflektiert und unwissenschaftlich angesehen wurde. Daneben bereitete in erster Linie Postmans Konzentration auf amerikanische Verhältnisse europäischen Kritikern Probleme: Zum einen waren viele der genannten Personen in Europa unbekannt, zum anderen konnten ganze Themenbereiche (insbesondere die Kritik an den Fernsehpredigern) nicht auf europäische Verhältnisse übertragen werden.
Viele der von Postman angesprochenen Nachteile der Bildkultur werden, auch aufgrund neuerer wissenschaftlicher Untersuchungen, heute differenzierter betrachtet. Dennoch bietet gerade die aktuelle Fernsehlandschaft für Postmans Appell gegen das "Idioten erzeugende Fernsehen" ("Fernsehen wurde nicht für Idioten erschaffen - es erzeugt sie.") noch immer genügend Angriffsfläche. So wird Postman noch heute gern herangezogen, wenn es um die Kritik an immer niveauloseren Fernsehshows geht. Und dennoch ist das nur die halbe Wahrheit, hat doch dieselbe Niveaulosigkeit längst auch Einzug in die Schriftkultur gehalten, etwa in Form von ganzen Stapeln überflüssiger Prominentenbiografien. Ob sich die heute aktuellen Probleme wie die Bildungsmisere oder eine um sich greifende politische Resignation sämtlich auf den negativen Einfluss des Fernsehens zurückführen lassen, ist wohl eher zweifelhaft.
Über den Autor
Neil Postman wird am 8. März 1931 in New York geboren. Seine Eltern ermöglichen ihm trotz geringer finanzieller Mittel (sein Vater ist Lastwagenfahrer) eine umfassende Bildung. Nach seinem Studium der Erziehungswissenschaften an der State University of New York promoviert er 1959 an der Columbia University. Danach lehrt Postman Kommunikationswissenschaft an der Universität von New York. Bereits früh beschäftigt er sich mit den Aufgaben und Zielen der Schulbildung, die er bald darauf vor allem in der Vermittlung des Schriftwissens sieht, das durch den Einfluss des Fernsehens immer mehr an Bedeutung verliert. 1971 gründet Postman ein Programm zur "Medienökologie", worunter der maßvolle Umgang mit Medien zu verstehen ist. 1986 erhält er den George-Orwell-Preis für Klarheit in der Sprache. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Lesen in Mainz und verschiedenen deutschen Verlagen versucht er auch die deutsche Lesekultur positiv zu beeinflussen. Zeit seines Lebens misstraut Postman der modernen Technik: Er lehnt es u. a. ab, etwas anderes als seinen Füller zum Schreiben zu benutzen. In 18 Büchern und über 200 Artikeln setzt er sich mit den Auswirkungen und Nachteilen des rasanten technologischen Fortschritts auseinander und kritisiert vor allem den damit einhergehenden Verfall menschlicher Werte. Noch 1992 wendet er sich mit seinem Werk Technopoly (Das Technopol) gegen die Annahme, die technischen Fortschritte des 20. Jahrhunderts seien eine wirkliche Verbesserung unserer Lebenswelt. Der wohl schärfste Kritiker der modernen Unterhaltungsindustrie stirbt am 5. Oktober 2003 in Flushing in der Nähe von New York im Alter von 72 Jahren an Lungenkrebs.
Meine markierten Stellen
Hat Ihnen die Zusammenfassung gefallen?
Buch kaufenDiese Zusammenfassung eines Literaturklassikers wurde von getAbstract mit Ihnen geteilt.
Wir finden, bewerten und fassen relevantes Wissen zusammen und helfen Menschen so, beruflich und privat bessere Entscheidungen zu treffen.
Sind Sie bereits Kunde? Melden Sie sich hier an.










Kommentar abgeben