- Drama
- Weimarer Klassik
Worum es geht
Riss in der Identität
Für das schlichte Gemüt des Dieners Sosias ist die Sache mit der Identität am Anfang des Amphitryon so klar wie nur irgendetwas. Er weiß: Ich bin ich. Und wenn er für diese Behauptung Prügel bezieht, schleudert er seinem Peiniger entgegen: „Dein Stock kann machen, dass ich nicht mehr bin. Doch nicht, dass ich nicht Ich bin, weil ich bin.“ Nur: Was passiert, wenn sonst niemand erkennt, wer man zu sein glaubt? Sosias’ Herr, Amphitryon, und dessen Frau Alkmene machen die schmerzliche Erfahrung, dass manchmal aus heiterem Himmel nichts mehr so ist, wie es scheint. Während Heinrich von Kleist dies schrieb, machte er gerade eine Beamtenausbildung und wünschte sich nichts sehnlicher, als von der Gesellschaft als Dichter anerkannt zu werden. Stattdessen lag er die halbe Zeit mit Blähungen und Magenschmerzen im Bett und musste sich von dem rüstigen alten Goethe als Hypochonder verspotten lassen. Kleist ahnte früher als andere, dass niemand zwischen Schein und Sein zu unterscheiden vermag. Seine Zeitgenossen waren von dieser Botschaft heillos überfordert. Und wer will es ihnen verdenken? Selbst heute ist das Thema für viele ziemlich starker Tobak. In Amphitryon schafft es Kleist, den Riss in der menschlichen Identität aufs Tragischste und zugleich aufs Komischste darzustellen.
Zusammenfassung
Über den Autor
Heinrich von Kleist wird am 18. Oktober 1777 in Frankfurt an der Oder geboren, er stammt aus einer preußischen Offiziersfamilie. Als junger Gefreiter-Korporal nimmt er im ersten Koalitionskrieg gegen Napoleon an der Belagerung von Mainz und am Rheinfeldzug (1793 bis 1795) teil. Bald fühlt er sich vom Offiziersberuf abgestoßen und wendet sich der Wissenschaft zu. Durch seine Kant-Lektüre verliert er jedoch den Glauben an einen objektiven Wahrheitsbegriff und erkennt, dass er nicht zum Gelehrten geschaffen ist. Ebenso wenig fühlt sich der enthusiastische Kleist zum Staatsdiener berufen. 1801 bricht er aus seiner bürgerlichen Existenz aus, reist nach Paris und später in die Schweiz, wo er als Bauer leben will. Doch auch daraus wird nichts. Schon während seiner Zeit in Paris beginnt Kleist zu dichten. Seine Theaterstücke, die heute weltberühmt sind, bleiben zunächst erfolglos. Von 1801 bis 1811 entstehen unter anderem die Tragödien Die Familie Schroffenstein (1803), Robert Guiskard und Penthesilea (beide 1808), außerdem Das Käthchen von Heilbronn (1808), Die Hermannsschlacht (1821 postum erschienen), die Komödien Amphitryon (1807) und Der zerbrochne Krug (1808) sowie die Erzählungen Die Marquise von O.... (1808), Das Bettelweib von Locarno (1810) und Die Verlobung in St. Domingo (1811). 1810 verweigert der preußische Staat Kleist, der nach Stationen in Königsberg und Dresden wieder in Berlin lebt, eine Pension. Auch aus dem Königshaus erhält er keine Anerkennung, obwohl er der Schwägerin des Königs das patriotische Stück Prinz Friedrich von Homburg widmet. Dennoch ist es wohl weniger äußere Bedrängnis als innere Seelennot, die Kleist schließlich in den Freitod treibt. Am 21. November 1811 erschießt er zunächst seine unheilbar kranke Freundin Henriette Vogel und danach sich selbst am Kleinen Wannsee in Berlin.


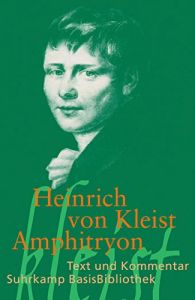






Kommentar abgeben