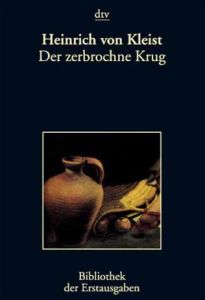
- Komödie
Worum es geht
Lustspiel um richterliche Autorität und ihren Missbrauch
Heinrich von Kleists Drama Der zerbrochne Krug wurde 1808 von keinem Geringeren als Goethe in Weimar zur Uraufführung gebracht – es war ein grandioser Misserfolg. Warum? Das Publikum fühlte sich durch das Stück irritiert. Ein Richter muss darin seinen eigenen Fall aufklären, mehr noch: Um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, spricht der Richter nicht Recht, sondern Unrecht. Kleist untergräbt bei seinem Publikum das Vertrauen in eine Gerichtsbarkeit, die ja erst wenige Jahrzehnte zuvor, im Zeitalter der Aufklärung, vom Adel auf das Bürger- und Bauerntum übergegangen war. Man war nun nicht mehr der Willkür der adeligen Richter ausgesetzt. Im Stück erscheint die Hoffnung auf eine sachliche Rechtsprechung als Illusion. Kleist bringt einen korrupten Richter aus dem bäuerlichen Milieu auf die Bühne, der sein Amt missbraucht, um seine Erpressung des Bauernmädchens Eve zu vertuschen. Die Folgen dieses moralischen Versagens stellen sich unverzüglich ein: Die übergeordnete richterliche Obrigkeit, verkörpert durch den Gerichtsrat Walter aus der Stadt Utrecht, erfährt eine Wiederaufwertung. Kleist zeigt in seinem Stück, wie sehr das Funktionieren der Gerichtsbarkeit von der moralischen Integrität ihrer Vertreter abhängt. Dabei gelingen ihm herrlich hintergründig-komische Wortwechsel seiner Figuren – sicher ein Grund für die andauernde Beliebtheit des Stücks.
Zusammenfassung
Über den Autor
Heinrich von Kleist wird am 18. Oktober 1777 in Frankfurt an der Oder geboren, er stammt aus einer preußischen Offiziersfamilie. Als junger Gefreiter-Korporal nimmt er im ersten Koalitionskrieg gegen Napoleon an der Belagerung von Mainz und am Rheinfeldzug (1793 bis 1795) teil. Bald fühlt er sich vom Offiziersberuf abgestoßen und wendet sich der Wissenschaft zu. Durch seine Kant-Lektüre verliert er jedoch den Glauben an einen objektiven Wahrheitsbegriff und erkennt, dass er nicht zum Gelehrten geschaffen ist. Ebenso wenig fühlt sich der enthusiastische Kleist zum Staatsdiener berufen. 1801 bricht er aus seiner bürgerlichen Existenz aus, reist nach Paris und später in die Schweiz, wo er als Bauer leben will. Doch auch daraus wird nichts. Schon während seiner Zeit in Paris beginnt Kleist zu dichten. Seine Theaterstücke, die heute weltberühmt sind, bleiben zunächst erfolglos. Von 1801 bis 1811 entstehen unter anderem die Tragödien Die Familie Schroffenstein (1803), Robert Guiskard und Penthesilea (beide 1808), außerdem Das Käthchen von Heilbronn (1808), Die Hermannsschlacht (1821 postum erschienen), die Komödien Amphitryon (1807) und Der zerbrochne Krug (1808) sowie die Erzählungen Die Marquise von O.... (1808), Das Bettelweib von Locarno (1810) und Die Verlobung in St. Domingo (1811). 1810 verweigert der preußische Staat Kleist, der nach Stationen in Königsberg und Dresden wieder in Berlin lebt, eine Pension. Auch aus dem Königshaus erhält er keine Anerkennung, obwohl er der Schwägerin des Königs das patriotische Stück Prinz Friedrich von Homburg widmet. Dennoch ist es wohl weniger äußere Bedrängnis als innere Seelennot, die Kleist schließlich in den Freitod treibt. Am 21. November 1811 erschießt er zunächst seine unheilbar kranke Freundin Henriette Vogel und danach sich selbst am Kleinen Wannsee in Berlin.

















Kommentar abgeben oder Start Discussion