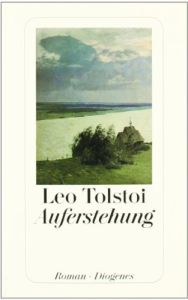
Auferstehung
- Roman
- Realismus
Worum es geht
Der geläuterte Aristokrat
Tolstoi verdarb es sich auf seine alten Tage gründlich mit der russisch-orthodoxen Kirche: Er lehnte die kirchlichen Rituale ab und glaubte nicht an die mythologische Auferstehung, sondern an die reelle, rein irdische. In Auferstehung geht es deshalb auch nicht um das Leben nach dem Tod, wie der Titel suggeriert, sondern um die Rückkehr auf den rechten Pfad im Diesseits. Fürst Nechliudow ist Geschworener in einem Mordprozess. Dabei stellt er fest, dass es sich bei einer der Angeklagten um Katjuscha, eine Jugendliebe, handelt. Er forscht nach und findet heraus, dass seine Liebelei das damals minderjährige Mädchen auf die schiefe Bahn gebracht hat. Von ihrer Unschuld überzeugt und voller Scham setzt er alle Hebel in Bewegung, um Katjuscha aus den Mühlen der Justiz und vor dem Arbeitslager in Sibirien zu retten. Doch seine Bemühungen sind vergebens: Der Bürokratismus lullt ihn ein und ehe er sich's versieht, begleitet er sie in die Strafkolonie – wo es dann aber doch noch eine Art Happy End für beide gibt. Der Roman trägt Züge eines Lehrstücks, was die Kritik nicht allzu sehr schätzte. Bis heute steht er im Schatten von Tolstois anderen Romanen.
Zusammenfassung
Über den Autor
Leo Nikolajewitsch Tolstoi wird am 9. September 1828 in Jasnaja Poljana in eine russische Adelsfamilie hineingeboren. Weil er früh seine Eltern verliert, wird er von einer Tante erzogen. Zwischen 1844 und 1847 besucht er die Universität von Kasan, doch das Studium der Orientalistik und Rechtswissenschaft bricht er ohne Examen ab. Auch den ursprünglichen Plan, in den diplomatischen Dienst einzutreten, verwirft er. Von den Ideen Rousseaus beflügelt, versucht er das System der Leibeigenschaft auf seinen Gütern abzuschaffen, was ihm jedoch nicht gelingt. Nach Jahren des Nichtstuns und angesichts angehäufter Spielschulden meldet er sich 1851 freiwillig zum Militärdienst. Er nimmt an den Kämpfen im Kaukasus und am Krimkrieg teil. Ab 1856 geht er auf zwei größere Europareisen. Nach seiner Hochzeit mit der erst 18-jährigen Sofia Andrejewna Bers, mit der er 13 Kinder haben wird, lässt er sich 1862 an seinem Geburtsort nieder und verzeichnet erste kleine schriftstellerische Erfolge. Ab 1869 erleidet Tolstoi eine tiefe Sinnkrise, nicht zuletzt, weil ihm die Widersprüche zwischen seinem eigenen Leben im Wohlstand und seinen politischen Überzeugungen unauflösbar erscheinen. Er liest Schopenhauer, was seine pessimistische Grundeinstellung noch weiter vertieft. Seine Arbeit wird zunehmend von ethischen und religiösen Themen bestimmt. Unter diesen Vorzeichen entstehen auch seine großen Romane Krieg und Frieden (1868/69) und Anna Karenina (1875–1877). 1901 lehnt er den Nobelpreis für Literatur ab, weil ihm inzwischen jede Art von Organisation – sogar soziale und kulturelle – suspekt ist; auch die Exkommunikation aus der russisch-orthodoxen Kirche (er weigert sich u. a., die Dreieinigkeit Gottes anzuerkennen) im selben Jahr nimmt er gelassen hin. Im November 1910 versucht er seiner zunehmend zerrütteten Ehe durch eine heimliche Flucht zu entkommen und will künftig besitzlos und einsam leben. Auf der Bahnstation von Astapowo stirbt er noch im gleichen Monat, am 20. November 1910, an einer Lungenentzündung.










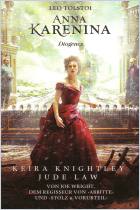



Kommentar abgeben oder Diskussion beginnen