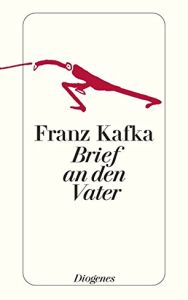
Brief an den Vater
- Autobiografie
- Moderne
Worum es geht
Briefliche Anklage
Kafka, ein Name, den heute viele mit Rätsel, Mysterium oder Beunruhigung in Verbindung bringen – dieser Name bedeutete für Franz Kafka etwas völlig anderes: polternde Stärke, Stattlichkeit, Energie und Selbstbewusstsein. Kafka, das war sein Vater, Hermann Kafka. Der Sohn, der Zweifelnde, Schwächliche, Zögernde, der eher nach der Mutter kam, schrieb seinem Vater im November 1919 einen Brief – den dieser aber nie erhielt. Es ist eine Anklage, eine Beweissammlung von Erziehungsfehlern, eine hundertseitige Abrechnung mit einer stets als übermächtig empfundenen Person, die das ganze Leben des Schriftstellers bestimmte. Für den Leser ergibt sich das Bild eines riesenhaften, dröhnenden Tyrannen und eines gleichzeitig lächerlichen, ungebildeten Mannes ohne Tischmanieren. Die Faszination von Kafkas Brief liegt nicht zuletzt in diesen Übertreibungen. Der Text weist weit über einen individuellen Konflikt und die konkrete Vaterfigur hinaus: Deutlicher noch als die größeren Werke zeigt er, wie Kafkas Literatur funktioniert und wo die für ihn typische Atmosphäre existenziellen Ausgeliefertseins ihren Anfang nimmt: im Elternhaus. So gesehen ist der Vater dann doch wieder eine kafkaeske Figur.
Zusammenfassung
Über den Autor
Franz Kafka wird am 3. Juli 1883 in Prag geboren. Als deutschsprachiger Jude gehört er gleich in doppelter Hinsicht einer Minderheit an. Der Vater Hermann Kafka ist Kaufmann, die Mutter Julie im Geschäft des Vaters tätig; so wächst das Kind in der Obhut verschiedener Dienstboten auf. Der lebenstüchtige Vater bringt für seinen kränklichen, künstlerisch begabten Sohn kein Verständnis auf − ein Konflikt, der das gesamte Werk Kafkas prägen wird. Nach dem Abitur möchte Kafka eigentlich Philosophie studieren, entscheidet sich aber nach dem Willen des Vaters für Jura und promoviert 1906. Danach arbeitet er bei einer Unfallversicherung. Sein Beruf ist ihm eine Last, weil ihm zu wenig Zeit zum Schreiben bleibt; er erledigt die Arbeit aber gewissenhaft. Auf Schaffensphasen, in denen er Nächte durchschreibt, folgen längere unproduktive Abschnitte. 1902 lernt er Max Brod kennen, eine lebenslange Künstlerfreundschaft beginnt. Ab 1908 veröffentlicht er kurze und längere Erzählungen in Zeitschriften und als Buchpublikationen, darunter Die Verwandlung (1915) und Das Urteil (1916). Er beginnt drei Romane, Der Verschollene (später veröffentlicht unter dem Titel Amerika), Der Prozess und Das Schloss, stellt aber keinen fertig – für ihn ein fundamentales Scheitern. Kafkas Beziehungen zu Frauen sind problematisch. 1912 lernt er bei Max Brod die Berlinerin Felice Bauer kennen, mit der er sich zweimal verlobt und wieder entlobt. Auch die weiteren Beziehungen sind nicht von Dauer. 1917 erkrankt er an Tuberkulose. Immer wieder muss er seine berufliche Arbeit unterbrechen, um sich an Ferienorten, in Sanatorien oder bei seiner Schwester Ottla zu erholen. Die gewonnene Zeit kann er aber nicht in gewünschter Weise in Literatur umsetzen. Als er am 3. Juni 1924 stirbt, hat er Max Brod testamentarisch angewiesen, seine unveröffentlichten Manuskripte zu vernichten. Der Freund hält sich nicht daran und ermöglicht so den Weltruhm Franz Kafkas.









Kommentar abgeben