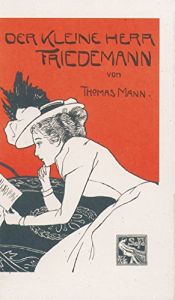
Der kleine Herr Friedemann
- Novelle
- Moderne
Worum es geht
Die Heimsuchung
Bereits in der Novelle Der kleine Herr Friedemann, einer seiner ersten Veröffentlichungen, schlägt Thomas Mann ein Thema an, das sich später wie ein roter Faden durch sein gesamtes Werk zieht: die Heimsuchung eines Menschen durch eine lang unterdrückte Sehnsucht, die plötzlich mit aller Gewalt und Leidenschaftlichkeit aufbricht und den Protagonisten gegen seinen Willen überwältigt und zerstört. So geht es auch dem kleinen, verkrüppelten Herrn Friedemann. Der hat schon seit seiner Jugendzeit eingesehen, dass er sich in einer Gesellschaft, die vor allem auf Äußerlichkeiten achtet, kaum Hoffnung auf eine Liebesbeziehung machen kann. Mit dieser Tatsache beginnt er sich abzufinden und richtet sich sein Leben so genussvoll wie möglich ein. Doch schon kurz nach seinem 30. Geburtstag bricht das Unheil über ihn herein, und zwar in der Gestalt einer schönen Frau, in die er sich gegen seinen Willen verliebt. Obwohl er ahnt, dass dies seinen Untergang bedeutet, kann sich der kleine Herr Friedemann diesem Einbruch von Leidenschaft in sein Leben nicht entziehen. Das Thema der Heimsuchung ist auch im Leben von Thomas Mann selbst erkennbar, der in seinen Tagebüchern seine homoerotischen Neigungen eingesteht, sie aber nie auslebte.
Zusammenfassung
Über den Autor
Thomas Mann wird am 6. Juni 1875 in Lübeck geboren. Er ist der zweite Sohn einer großbürgerlichen Kaufmannsfamilie, sein älterer Bruder Heinrich wird ebenfalls Schriftsteller. Thomas hasst die Schule und verlässt das Gymnasium ohne Abitur. Nach dem Tod des Vaters zieht die Familie 1894 nach München, dort arbeitet Mann kurzfristig als Volontär bei einer Feuerversicherung. Als er mit 21 Jahren volljährig ist und aus dem Erbe des Vaters genug Geld zum Leben erhält, beschließt er, freier Schriftsteller zu werden. Er reist mit Heinrich nach Italien, arbeitet in der Redaktion der Satirezeitschrift Simplicissimus und schreibt an seinem ersten Roman Buddenbrooks, der 1901 erscheint und ihn sofort berühmt macht. Der Literaturnobelpreis, den er 1929 erhält, beruht vor allem auf diesem ersten Buch – Mann, nicht uneitel, erwartet die Auszeichnung allerdings schon 1927. Trotz seiner homoerotischen Neigungen heiratet er 1905 die reiche Jüdin Katia Pringsheim. Sie haben sechs Kinder, darunter Klaus, Erika und Golo Mann, die ebenfalls als Schriftsteller bekannt werden. Weil Thomas den Ersten Weltkrieg zunächst befürwortet, kommt es zwischen ihm und seinem Bruder Heinrich zum Bruch, der mehrere Jahre andauert. 1912 erscheint die Novelle Der Tod in Venedig, 1924 der Roman Der Zauberberg. In den 1930er Jahren gerät er ins Visier der Nationalsozialisten, gegen die er sich in öffentlichen Reden ausspricht; seine Schriften werden verboten. Nach der Machtergreifung Hitlers kehrt er von einer Vortragsreise nicht mehr nach Deutschland zurück. Zunächst leben die Manns in der Schweiz, 1938 emigrieren sie in die USA, 1944 nimmt Mann die amerikanische Staatsbürgerschaft an. 1947 erscheint Doktor Faustus, eine literarische Auseinandersetzung mit der Naziherrschaft. Nach dem Krieg besucht Thomas Mann Deutschland nur noch sporadisch; die von ihm vertretene Kollektivschuldthese verschafft ihm nicht nur Anhänger. Als die Manns 1952 nach Europa zurückkehren, gehen sie wieder in die Schweiz. Thomas Mann stirbt am 12. August 1955 in Zürich.









Kommentar abgeben