
Die Kreutzersonate
- Novelle
- Moderne
Worum es geht
Das Verhängnis der Ehe
Tolstois Alterswerk Die Kreutzersonate ist ein merkwürdiger Zwitter: Da ist einerseits das packende Drama einer vergifteten Ehe, die meisterhafte, psychologisch subtile Schilderung einer fatalen Zweisamkeit: Der Zugpassagier Posdnyschew erzählt einem Mitreisenden von seinem lockeren vorehelichen Geschlechtsleben, von der flüchtigen Verliebtheit, die ihn in die Heirat trieb, und von der Hölle, zu der ihm diese Ehe wurde. Aus Egoismus wurde Rechthaberei, aus Überdruss Hass, aus Eitelkeit rasende Eifersucht. Andererseits flicht Tolstoi einen moralischen Traktat ein, der es mit jeder Sittenpredigt von der Kanzel aufnehmen kann. Posdnyschew stellt das Ehe- und Geschlechtsleben seiner Zeit mit tabubrecherischer Deutlichkeit an den Pranger – und zieht die bizarre Schlussfolgerung, dass die Sexualität, auch in der Ehe, ein Übel sei, das man nur durch umfassende Enthaltsamkeit kurieren könne. Diese fundamentalistische Abhandlung mag für Tolstoi der Kern des Werks gewesen sein – für den heutigen Leser ist Die Kreutzersonate vor allem ein Höhepunkt realistischer Erzählkunst.
Zusammenfassung
Über den Autor
Leo Nikolajewitsch Tolstoi wird am 9. September 1828 in Jasnaja Poljana in eine russische Adelsfamilie hineingeboren. Weil er früh seine Eltern verliert, wird er von einer Tante erzogen. Zwischen 1844 und 1847 besucht er die Universität von Kasan, doch das Studium der Orientalistik und Rechtswissenschaft bricht er ohne Examen ab. Auch den ursprünglichen Plan, in den diplomatischen Dienst einzutreten, verwirft er. Von den Ideen Rousseaus beflügelt, versucht er das System der Leibeigenschaft auf seinen Gütern abzuschaffen, was ihm jedoch nicht gelingt. Nach Jahren des Nichtstuns und angesichts angehäufter Spielschulden meldet er sich 1851 freiwillig zum Militärdienst. Er nimmt an den Kämpfen im Kaukasus und am Krimkrieg teil. Ab 1856 geht er auf zwei größere Europareisen. Nach seiner Hochzeit mit der erst 18-jährigen Sofia Andrejewna Bers, mit der er 13 Kinder haben wird, lässt er sich 1862 an seinem Geburtsort nieder und verzeichnet erste kleine schriftstellerische Erfolge. Ab 1869 erleidet Tolstoi eine tiefe Sinnkrise, nicht zuletzt, weil ihm die Widersprüche zwischen seinem eigenen Leben im Wohlstand und seinen politischen Überzeugungen unauflösbar erscheinen. Er liest Schopenhauer, was seine pessimistische Grundeinstellung noch weiter vertieft. Seine Arbeit wird zunehmend von ethischen und religiösen Themen bestimmt. Unter diesen Vorzeichen entstehen auch seine großen Romane Krieg und Frieden (1868/69) und Anna Karenina (1875–1877). 1901 lehnt er den Nobelpreis für Literatur ab, weil ihm inzwischen jede Art von Organisation – sogar soziale und kulturelle – suspekt ist; auch die Exkommunikation aus der russisch-orthodoxen Kirche (er weigert sich u. a., die Dreieinigkeit Gottes anzuerkennen) im selben Jahr nimmt er gelassen hin. Im November 1910 versucht er seiner zunehmend zerrütteten Ehe durch eine heimliche Flucht zu entkommen und will künftig besitzlos und einsam leben. Auf der Bahnstation von Astapowo stirbt er noch im gleichen Monat, am 20. November 1910, an einer Lungenentzündung.










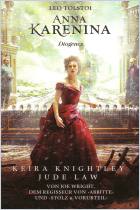



Kommentar abgeben oder Diskussion beginnen