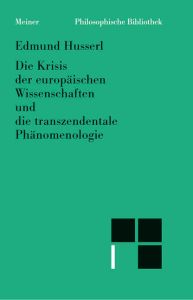
- Philosophie
- Moderne
Worum es geht
Gegen die Entmenschlichung der Wissenschaft
Edmund Husserl, der Vater der Phänomenologie, blickt in seinem unvollendeten Spätwerk zurück in die Geschichte der Philosophie und der Wissenschaften. Er beklagt, dass die Philosophie als Universalwissenschaft längst von Einzelwissenschaften abgelöst worden sei. Deren beispiellose Erfolge hätten aber in eine ernste Krise geführt: Dem alltäglichen Leben der Menschen, ihrer Sinnsuche und ihren Hoffnungen auf eine bessere Zukunft könnten sie nicht mehr gerecht werden. Husserl geht der Frage nach, wie es dazu kommen konnte. Seine Antwort: Die Wissenschaft habe sich schon vor langer Zeit von allem befreit, was sie nicht berechnen oder mit einer Formel ausdrücken könne. Die konkrete Lebenswelt des Menschen sei dabei ins Hintertreffen geraten. Husserl schrieb das Buch in einer Übergangsphase zwischen zwei Katastrophen: Die Wunden des Ersten Weltkriegs waren noch nicht verheilt und die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten stand kurz vor ihrem Höhepunkt. Entsprechend düster fallen seine Geschichtsurteile aus.
Zusammenfassung
Über den Autor
Edmund Husserl, der Begründer der Phänomenologie, wird am 8. April 1859 in Proßnitz (Mähren, heute Tschechische Republik) in eine jüdische Familie geboren. Er studiert in Leipzig, Berlin und Wien Astronomie, Mathematik, Physik und Philosophie. 1886 geht Husserl nach Halle, wo er an der Universität als Privatdozent lehrt und mit der Arbeit Über den Begriff der Zahl (1887) habilitiert. Kurz vor der Hochzeit mit seiner Verlobten Malvine Steinschneider lässt er sich evangelisch taufen. 1891 erscheint die Philosophie der Arithmetik, in der er die Gültigkeit mathematischer Wahrheiten unabhängig von der menschlichen Erkenntnis behauptet. Zehn Jahre später revidiert er seine Meinung in seinem ersten Hauptwerk, den Logischen Untersuchungen (1901). Das Buch bringt ihm den Ruf an die Universität Göttingen ein, wo er ab 1901 als außerordentlicher und ab 1906 als ordentlicher Professor lehrt. Dort entsteht Husserls eigene phänomenologische Schule, die zahlreiche Studenten anzieht. In seinem einflussreichsten Werk, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie (1913), formuliert er die Aufgabe der Phänomenologie, die Sachen so zu beschreiben, wie sie sich dem menschlichen Geist darstellten – unabhängig davon, ob die Sachen selbst überhaupt existierten. „Zu den Sachen selbst“ ist ein berühmt gewordener Ausspruch Husserls. Seine Ideen fallen auf fruchtbaren Boden, sodass er 1916 einen Ruf an die Universität von Freiburg erhält. Seine erste Assistentin ist Edith Stein, ihr Nachfolger Martin Heidegger, der seine eigenen Forschungen auf Husserls Erkenntnissen aufbauen wird. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wird Husserl zunächst beurlaubt. 1936 entzieht man ihm die Lehrerlaubnis und vertreibt ihn aus seinem Haus. Ein Angebot der University of Southern California lehnt er ab. Edmund Husserl stirbt am 27. April 1938 in Freiburg.











Kommentar abgeben oder Diskussion beginnen