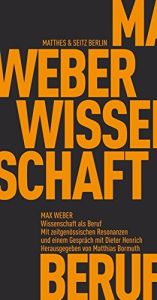
Wissenschaft als Beruf
Diese Ausgabe: Matthes & Seitz Berlin, 2017 Mehr
Seiten: 188
- Soziologie
- Moderne
Worum es geht
Wie viel Sinn steckt im Fortschritt?
Mitten im Ersten Weltkrieg hält Max Weber eine Rede vor Studenten mit dem Titel Wissenschaft als Beruf. Mit keinem Wort erwähnt er den Krieg, aber die katastrophalen Zeitumstände grundieren seine Analyse der Wissenschaft, die zugleich eine Diagnose der Moderne ist. Das wissenschaftliche Prinzip des Fortschritts wird kritisch hinterfragt, denn es hat kein höheres Ziel mehr, es läuft ins Leere und kann bedrohlich werden. Zugleich hat die Wissenschaftsorientierung für eine „Entzauberung der Welt“ gesorgt. Weber, der Wissenschaftler, der vielleicht eher Philosoph war, hinterfragt die Wissenschaft auf allen Ebenen, angefangen bei den ökonomischen Bedingungen für einen jungen Wissenschaftler. Verblüffend ist, dass nichts davon veraltet ist, weder die ungewisse Zukunft eines Privatdozenten noch die immer weiter gehende Spezialisierung der Fachgebiete noch die Fragen, die noch immer zu selten gestellt werden: was Wissenschaft darf, was sie soll und was sie kann.
Zusammenfassung
Über den Autor
Max Weber wird am 21. April 1864 in Erfurt als erstes Kind des Juristen Max Weber und dessen Frau Helene geboren. Die Großmutter mütterlicherseits ist strenggläubige Calvinistin. 1869 zieht die Familie nach Berlin, wo sich Max und seine Geschwister allerdings nicht wohlfühlen. Der Vater wird Abgeordneter der Nationalliberalen Partei. Weber studiert Jura, Nationalökonomie, Philosophie und Geschichte. Er wird im Fach Jura promoviert und habilitiert. Früh setzt er sich mit der Situation der Arbeiter auseinander und wird Mitglied verschiedener Vereine. 1893 heiratet er die spätere Frauenrechtlerin Marianne Schnitger. Seine Universitätskarriere beginnt vielversprechend: Weber wird Professor für Nationalökonomie in Freiburg und später in Heidelberg. Doch schon bald treten gesundheitliche Probleme auf. Von 1897 an muss er seine Lehrtätigkeit einschränken und 1903 ganz einstellen, denn er leidet unter einer depressiven Erkrankung. Es folgen mehrere Sanatoriumsaufenthalte und Erholungsreisen. 1904 erscheinen im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, das er selbst mitherausgibt, gleich zwei bedeutende Schriften: Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis und Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus. 1909 wird Weber Mitgründer der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Später trägt er immer mehr zur Etablierung der Soziologie als eigenständige wissenschaftliche Disziplin bei. 1913 beginnt er mit seinem Hauptwerk Wirtschaft und Gesellschaft. Weber äußert sich auch zunehmend zu tagespolitischen Fragen und ist 1918 an der Gründung der Deutschen Demokratischen Partei beteiligt. Ab Herbst 1918 geht er – inzwischen Professor an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität – eine heimliche Liebesbeziehung mit Else Jaffé-von Richthofen ein, bleibt aber seiner Frau Marianne eng verbunden. Am 14. Juni 1920, mit erst 56 Jahren, stirbt Max Weber in München an einer Lungenentzündung. Zwei Jahre später wird das Mammutwerk Wirtschaft und Gesellschaft aus dem Nachlass veröffentlicht.











Kommentar abgeben