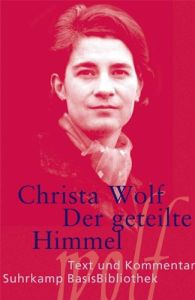
- Entwicklungsroman
- Nachkriegszeit
Worum es geht
Das Private ist politisch
Mit ihrem ersten Roman Der geteilte Himmel lieferte Christa Wolf ein Stimmungsbild der noch jungen DDR: Da ist einerseits die ältere Generation, die noch für Hitler gekämpft hat und sich nun ohne Weiteres einer neuen Ideologie unterordnet. Andererseits gibt es eine junge Generation, die sich für den Aufbau einer neuen Gesellschaft einsetzt, dabei aber pausenlos mit Widersprüchen konfrontiert wird: mit den Missständen der Planwirtschaft, den verrußten Städten, der Sturheit der Parteifunktionäre, den sinnlosen ideologischen Vorgaben. Wolfs Roman ist alles andere als plakative Propaganda im Stil des sozialistischen Realismus, sondern ein vielschichtiges und erstaunlich kritisches Porträt der DDR um 1960. Der geteilte Himmel zeigt in sorgfältigen Formulierungen die Schattenseiten der DDR auf und entlarvt ihre Typen. Trotz verklärender und schwärmerischer Tendenzen ist das Buch ein sprachlich dichter und formell ausgefeilter Roman, den zu lesen sich auch Jahrzehnte nach dem Mauerfall noch lohnt.
Zusammenfassung
Über den Autor
Christa Wolf wird am 18. März 1929 in Landsberg an der Warthe geboren. Nach der Vertreibung 1945 lässt sich ihre Familie in Mecklenburg-Vorpommern nieder. Wolf arbeitet zunächst als Schreibkraft und macht 1949 ihr Abitur. Im selben Jahr tritt sie der SED (Sozialistische Einheitspartei) bei. Während des Germanistikstudiums lernt sie ihren späteren Mann, den Schriftsteller Gerhard Wolf, kennen. Nach dem Studium arbeitet Christa Wolf zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin für den Deutschen Schriftstellerverband, dann als Verlagslektorin und als Redakteurin einer Literaturzeitschrift. Ab 1962 ist sie freie Schriftstellerin. Ein Jahr darauf erscheint der Roman Der geteilte Himmel, eine Auseinandersetzung mit dem Mauerbau und mit unterschiedlichen Lebensentwürfen in beiden Teilen Deutschlands. Christa Wolf gilt als Vorzeigeintellektuelle der jungen DDR, doch schon bald gerät sie wegen ihres subjektiven Stils und der Behandlung kontroverser Themen in Konflikt mit dem Machtapparat. Ihr zweiter Roman Nachdenken über Christa T. (1968) erscheint zunächst nur in kleiner Auflage. 1976 unterstützt die Autorin den Protest gegen die Zwangsausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Bei aller Kritik bleibt sie der Idee des Sozialismus dennoch treu. Als sogenannte „loyale Dissidentin“ darf sie reisen, hält Vorträge im Ausland und wird zunehmend als gesamtdeutsche Schriftstellerin anerkannt. 1980 erhält sie den renommierten westdeutschen Georg-Büchner-Preis. 1983 erscheint ihre Erfolgserzählung Kassandra. Nach dem Fall der Mauer setzt Wolf sich für den „dritten Weg“ einer reformierten DDR und gegen die Wiedervereinigung ein. 1993 gibt sie zu, zwischen 1959 und 1962 als IM (inoffizielle Mitarbeiterin) für die Stasi gearbeitet zu haben, weist aber auch darauf hin, dass sie ab 1969 permanent von der Spitzelbehörde überwacht wurde. In den 90er-Jahren diffamieren westliche Kritiker die einst gefeierte Schriftstellerin als „Staatsdichterin der DDR“. Sie stirbt am 1. Dezember 2011 in Berlin.












Kommentar abgeben oder Start Discussion