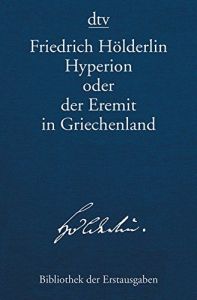
- Briefroman
- Romantik
Worum es geht
Sehnsucht nach einer besseren Welt
Alle Jahre wieder geht er um wie ein Virus: der Wunsch, alles stehen und liegen zu lassen, auf dem Jakobsweg zu wandern oder mit dem Segelboot die Welt zu umrunden. Ob bewusst oder nicht: All die Zivilisationsmüden treten in die Fußstapfen des griechischen Einsiedlers Hyperion, erfunden von Friedrich Hölderlin. Hyperions Lebensgeschichte ist Hölderlins literarische Anklage gegen das spießbürgerliche, dumpfe und materialistische Deutschland seiner Zeit, das ihm als Künstler und Idealisten kaum Luft zum Atmen ließ. Seine Sprache war schon damals gewöhnungsbedürftig und ist es heute erst recht: Da „säuseln holdselige Tage“, es neigen sich „lispelnde Bäume“ und es „gährt das Leben“. Doch die Fragen des lange verkannten Genies sind nicht aus der Welt: Wie kann der Mensch seine Vereinzelung überwinden? Auf welchem Weg eine bessere Welt schaffen? Und wie im Einklang mit der Natur leben? Das antike Griechenland mag heute als Vorbild ausgedient haben, aber die Suche nach Antworten auf diese Fragen bleibt aktuell.
Zusammenfassung
Über den Autor
Friedrich Hölderlin wird am 20. März 1770 als erstes Kind eines Klosterhofmeisters und einer Pfarrerstochter geboren. Er studiert am Tübinger Stift, um auf Drängen der Mutter Pfarrer zu werden, und freundet sich mit den späteren Philosophen Hegel und Schelling an. Hölderlin entscheidet sich gegen die geistliche Laufbahn und nimmt 1793 auf Empfehlung Schillers eine Stelle als Hauslehrer bei der Familie Charlotte von Kalbs an. Dort beginnt er eine Beziehung mit der jungen Witwe Wilhelmine Kirms, die ein Jahr später eine Tochter zur Welt bringt. 1795 geht Hölderlin nach Jena, um Vorlesungen Fichtes zu hören, und freundet sich mit dem angehenden Diplomaten Isaac von Sinclair an. Im Sommer verlässt er fluchtartig die Stadt, warum bleibt unbekannt. Anfang 1796 zieht er als Hauslehrer bei dem Frankfurter Bankier Jacob Gontard ein und beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit dessen Frau Susette, dem Vorbild für Diotima aus dem Roman Hyperion (1797/99), den er zu dieser Zeit fertigstellt. Der Hausherr erfährt davon und entlässt Hölderlin, dieser trifft sich jedoch weiter heimlich mit Susette, zuletzt 1800. Es entstehen zahlreiche Gedichte, darunter Der Wanderer, Brot und Wein, Der Archipelagus und Hälfte des Lebens, sowie die unvollendete Tragödie Der Tod des Empedokles (1797–1800). Ende 1801 wandert Hölderlin nach Bordeaux und tritt dort seine vierte Hauslehrerstelle an. Möglicherweise hört er davon, dass Susette krank geworden ist, auf jeden Fall macht er sich im Mai wieder zu Fuß auf den Rückweg. Verstört und verwahrlost erreicht er im Juni Stuttgart, wo er vom Tod seiner Geliebten erfährt. Sinclair kümmert sich um ihn. 1805 wird der Diplomat eines Umsturzversuchs verdächtigt und des Hochverrats angeklagt; Hölderlin gilt als Mitverschworener. Die Vorwürfe erweisen sich als haltlos, und Hölderlins zunehmende Schizophrenie verhindert, dass er vor Gericht kommt. 1806 wird er in eine Klinik eingeliefert und bald darauf als unheilbar entlassen. Der Tübinger Tischler Ernst Zimmer nimmt ihn bei sich auf. Die folgenden 36 Jahre verbringt Hölderlin in einem Zustand geistiger Umnachtung. Er stirbt am 7. Juni 1843.








Kommentar abgeben