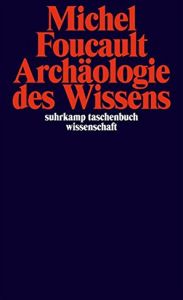
- Philosophie
- Gegenwart
Worum es geht
Die Abschaffung des Subjekts
Michel Foucaults Abhandlung Archäologie des Wissens rief nach ihrem Erscheinen 1969 sowohl Begeisterung als auch Ablehnung hervor. Das Werk ist das einzige des französischen Poststrukturalisten, in dem er ausführlich seine Methode darlegt. Gleich zu Beginn grenzt Foucault sich von der traditionellen Ideengeschichte ab, von ihrer teleologischen Ausrichtung und ihren Kategorien wie „Epoche“, „Werk“, „Tradition“ oder „Autor“. Stattdessen, so Foucault, seien Texte als Teil von Diskursen zu sehen und auf die Arten und Regeln diskursiver Praktiken zu untersuchen, die in ihnen zum Vorschein kommen. So könnten Brüche und Diskontinuitäten erkannt werden. Nur indem man eine Aussage von vorgefertigten Mustern befreit, so Foucault, lassen sich tatsächliche, neue Beziehungen innerhalb eines Diskurses erkennen. Mit ironischem Gestus weist er auf die Grenzen des abendländischen Vernunftdenkens und die Selbstüberhöhung des bürgerlichen, vermeintlich souveränen Subjekts hin. Das brachte ihm den Vorwurf ein, er verfolge eine antiaufklärerische, antiemanzipatorische Stoßrichtung. Ein hochabstraktes Werk, an dem sich bis heute die Geister scheiden.
Take-aways
Über den Autor
Michel Foucault wird am 15. Oktober 1926 in Poitiers geboren. Dort besucht er zwischen 1940 und 1945 das jesuitische Gymnasium. Ab 1945 lebt er in Paris, wo er an der Eliteuniversität École normale supérieure Philosophie und Psychologie studiert. Nach Abschlüssen in diesen Fächern lehrt er dort von 1950 bis 1955 Psychologie und ist zugleich zeitweise Assistent an der Universität von Lille. Er nimmt Lehrtätigkeiten in Schweden und Warschau an und ist 1959/60 als Direktor des Institut français in Hamburg tätig. Nietzsche, Marx, Freud und Heidegger prägen Foucaults Denken. In seiner 1961 veröffentlichten Dissertation Wahnsinn und Gesellschaft (Folie et déraison) untersucht er, wie der Wahnsinn im Verlauf der Geschichte mittels definitorischer Macht von der Vernunft unterschieden wird. Machtstrukturen, die Rolle des Wissens bei ihrer Herausbildung und ihre Beziehungen zum Individuum werden zu den zentralen Themen seines Schaffens. In Die Ordnung der Dinge (Les mots et les choses, 1966) beschäftigt er sich mit der Entstehung der Humanwissenschaften. Seine wissenschaftliche Karriere führt ihn über die Universität von Clermont-Ferrand und eine zweijährige Gastprofessur an der Universität in Tunis zurück nach Paris, wo er ab 1968 überwiegend lebt. Ab 1970 hat er den eigens für ihn geschaffenen Lehrstuhl für die Geschichte der Denksysteme am Collège de France inne. Foucaults Denkmethode ist am ehesten der philosophischen Richtung des Poststrukturalismus (und damit der Postmoderne) zuzuordnen. 1963 beginnt Foucault mit Die Geburt der Klinik (Naissance de la clinique) die Entstehung von Institutionen zu erforschen, was er 1975 mit Überwachen und Strafen (Surveiller et punir) fortsetzt. In seinem zwischen 1976 und 1984 in drei Bänden veröffentlichten letzten großen Werk Sexualität und Wahrheit (Histoire de la sexualité) analysiert er die Sexualität aus psychiatrischer, rechtlicher und moralischer Perspektive. Als einer der einflussreichsten Philosophen der Neuzeit stirbt Foucault am 25. Juni 1984 in Paris an den Folgen von Aids.













Kommentar abgeben oder Diskussion beginnen