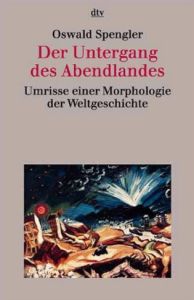
- Philosophie
- Moderne
Worum es geht
Das Buch zum Zeitgeist nach dem Ersten Weltkrieg
Die Weltgeschichte als Geschichte des stetigen Fortschritts: Von der finsteren Barbarei der Vorzeit, über schmerzliche Kriege und lange Lernprozesse hat sich die Menschheit eine sichere Zivilisation erarbeitet und geht weiterhin einer glänzenden Zukunft entgegen, so die weit verbreitete Ansicht. Gegen solchen Fortschrittsoptimismus erhob Oswald Spengler wortgewaltig Einspruch. In seiner über 1000-seitigen Geschichtsphilosophie Der Untergang des Abendlandes legte er eine Art Lebenszyklustheorie der Hochkulturen vor: Alle Kulturen der Welt ähneln sich demnach in bestimmten Phasen; das ist ihre Homologie – ein Begriff, den Spengler der Biologie entlehnte. Der Clou dieses Verfahrens, für das er von den Fachwissenschaftlern stark kritisiert wurde: Es ließen sich Aussagen darüber machen, wie sich die Kultur des Abendlandes weiterentwickeln würde. Spengler kam zu dem niederschmetternden Ergebnis, das dem Buch den Titel gibt: Die Zeit des Abendlandes sei so gut wie abgelaufen, mit der modernen Zivilisation sei es in die letzte Phase des Verfalls eingetreten. Eine spannende These, die viel Staub aufwirbelte. Spenglers von Goethe und Nietzsche beeinflusstes Werk ist eines der wirkmächtigsten des 20. Jahrhunderts. Auch heute noch werden hin und wieder ähnliche Thesen geäußert, etwa von Samuel Huntington (Kampf der Kulturen).
Zusammenfassung
Über den Autor
Oswald Spengler wird am 29. Mai 1880 in Blankenburg im Harz geboren. Als Kind fällt er durch Panikattacken und Nervosität auf. Seine spätere Leidenschaft für Geschichte zeigt sich schon früh: Bereits mit 15 Jahren macht er sich Notizen zu zwei fiktiven Reichen: „Afrikasien“ und „Großdeutschland“. Nach dem Besuch eines pietistischen Gymnasiums in Halle schreibt er sich 1899 an der dortigen Universität ein und studiert Naturwissenschaften und Mathematik. Einzelne Semester verbringt er auch an den Universitäten von Berlin und München. Vor allem in den Künstlervierteln von München fühlt Spengler sich wohl, das Universitätsleben hingegen langweilt ihn: Er lernt nur den nötigsten Stoff, sodass er gerade so durch die Prüfungen kommt. Nach dem Staatsexamen und der Dissertation über den griechischen Philosophen Heraklit, die erst im zweiten Anlauf von der Prüfungskommission akzeptiert wird, arbeitet er als Gymnasiallehrer. 1910 stirbt Spenglers Mutter. Das Ereignis stellt eine Zäsur in seinem Leben dar: Er gibt die Lehrtätigkeit auf und zieht aus dem ihm verhassten nasskalten Klima Hamburgs nach München. Materiell und psychisch instabil macht er sich hier an die Verfertigung seiner großen Schrift Der Untergang des Abendlandes. 1919 bricht der von seinem Buch ausgelöste „Spengler-Streit“ aus und Spengler lehnt den Ruf der Universität von Göttingen ab: Er wolle sich ganz auf sein Werk konzentrieren. In den folgenden Jahren veröffentlicht er mehrere historische und politische Schriften, darunter Preußentum und Sozialismus (1919), Neubau des Deutschen Reiches (1924) und Der Mensch und die Technik (1931). 1923 wird er Zeuge des Münchner Hitlerputsches und wird 1925 von SA-Mitglied Gregor Strasser zur Mitarbeit an den Nationalsozialistischen Monatsheften aufgefordert. Spengler lehnt ab. Die „Lösung des Antisemitismus“ der Nationalsozialisten bezeichnet er als primitiv, dennoch wählt er 1932 die NSDAP („Hitler ist ein Dummkopf, aber die Bewegung muss man unterstützen“). 1933 kommt er mehreren Angeboten der Nationalsozialisten (u. a. einem Ruf an die Universität Leipzig) nicht nach. Spätestens 1934 verwandelt sich seine latente Verachtung von Hitlers Partei in Hass. 1935 tritt er vom Vorsitz des Nietzsche-Archivs zurück, weil ihm die einseitige Auslegung des von ihm so verehrten Philosophen durch die Nazis missfällt. Zuvor hat ihn das Reich aber schon zur Persona non grata erklärt. Am 8. Mai 1936 stirbt Spengler in München an Herzversagen.








Kommentar abgeben